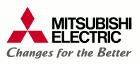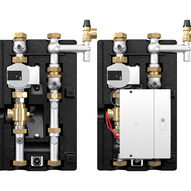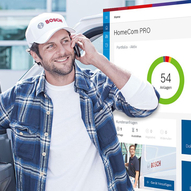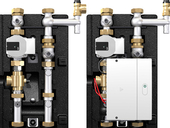Wärmepumpe im Altbau: 10 Tipps für Einbau und Betrieb
Präzise Planung und korrekter Einbau für Effizienz
Kein Thema treibt Eigentümer derzeit so um wie die Wärmepumpe. Kann die Wärmepumpe meine alte Heizung ablösen? Eignet sich die Technik für meinen Altbau? Fakt ist: Die Effizienz und der störungsfreie Betrieb einer Wärmepumpe hängen von präziser Planung und korrektem Einbau ab! Eine Kurzstudie gibt Hinweise, wie die 10 gängigsten Fehler vermieden werden können. Die besten Tipps für Einbau und Betrieb einer Wärmepumpe im Altbau.
Ob und in welchem Umfang eine Wärmepumpe das Klima und den Geldbeutel entlastet, hängt von einer präzisen Planung und einer korrekte Montage ab. Erfahrungsberichte von Eigentümern und Experten zeigen, dass hierbei noch viel Luft nach oben ist. Aus diesem Grund hat der Bauherren-Schutzbundes e.V. (BSB) eine Studie beim Institut für Bauforschung (IfB) in Auftrag gegeben, die die häufigsten Fehler beim Einbau und Betrieb von Wärmepumpen benennt und Hinweise gibt, wie diese vermieden werden können.
Auf diese 10 Punkte sollten Eigentümer:innen und Fachbetriebe besonders achten:
1. Wärmepumpe im Reihenhaus: Auf korrekte Abstände achten
Wird in ein bestehendes Reihenmittelhaus eine Luft-Wärmepumpe eingebaut, müssen die Abstandsregeln zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden. Laut Musterbauordnung beträgt dieser drei Meter. Wird dieser Abstand unterschritten, dürfen die Grundstücksnachbarn den Rückbau der Wärmepumpe verlangen. Kann der Abstand nicht eingehalten werden, könnte eine Split-Wärmepumpe zum Einsatz kommen, bei der nur die Ventilatoreneinheit im Außenbereich und die Hydraulikstation im Keller untergebracht wird.
2. Warme Wohnräume trotz EVU-Sperre
Wer günstigen Wärmepumpenstrom bezieht, muss sich auf ein regelmäßiges Abschalten der Wärmepumpe aufgrund EVU-Sperre einstellen. Diese Sperrzeit für Wärmepumpen wird vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) eingerichtet und soll das Stromnetz in Spitzenlastzeiten (vor allem morgens und abends) entlasten.
Im Kalten muss deshalb dennoch niemand sitzen, denn bei der Planung der Wärmepumpe kann vorgesorgt werden: So können zusätzlich zur Wärmepumpe ein Pufferspeicher oder ein elektrischer Heizstab installiert werden. Der Betrieb solcher Heizstäbe ist sehr energieintensiv, allerdings in der Regel auch nur an sehr kalten Tagen nötig. Eine weitere Variante ist der sogenannte bivalente Betrieb, in dem die Wärmepumpe durch ein zweites, nicht elektrisch betriebenes Heizsystem unterstützt wird. Hierfür werden zum Beispiel Gas-Brennwertthermen eingesetzt.
3. Geräuschbelästigung durch das Außengerät der Wärmepumpe verhindern
Beim Kauf einer außen aufzustellenden Wärmepumpe sollte unbedingt auf den Schallschutz geachtet werden - das gilt sowohl für das Gerät selbst als auch in Bezug auf den Aufstellort. Entscheidend ist der Schall-Leistungspegel, der im technischen Datenblatt angegeben ist. Viele Wärmepumpen schalten mittlerweile auch in einen leiseren Nachtbetrieb. Beim Aufstellen sollte auf schutzbedürftige Räume wie Kinder- und Schlafzimmer Rücksicht genommen werden - und zwar sowohl auf eigene als auch die der Nachbarn. Um Schallreflexionen zu vermeiden, sollten die Wärmepumpe zudem mehrere Meter Abstand halten zu Garagen, Häuserfassaden oder anderen großen Flächen.
4. Brummen und Vibrieren bei Montage an der Außenwand vermeiden
Damit es beim Betrieb einer Wärmepumpe nicht zu störenden Schwingungen und "Begleitgeräuschen" kommt, sollte das Gerät möglichst gut vom tragenden Untergrund (Boden, Wand) entkoppelt werden. Möglich ist dies zum Beispiel durch den Einsatz von Schwingungsdämpfern, die unter dem Gerät befestigt werden, und somit die Weiterleitung des (Körper-)Schalls unterbinden. Geeignet ist auch das Aufstellen auf einer speziellen Schallschutzmatte, wie sie häufig unter Waschmaschinen genutzt wird. Grundsätzlich sollten Wärmepumpen auf ebenen Untergründen aufgestellt und schwingfähige Böden vermieden werden.
5. Wärmepumpe in unsaniertem Haus - hohe Heizkosten vermeiden
Damit Wärmepumpen effizient arbeiten, sollte die benötigte Vorlauftemperatur möglichst gering sein. Eine sorgfältige Planung der Anlage unter Berücksichtigung des energetischen Zustands des bestehenden Gebäudes ist daher unerlässlich. Ein unsaniertes Haus mit einem hohen Wärmebedarf führt häufig zu hohen Energiekosten. Hier sind zunächst Dämmung und Fenstertausch empfehlenswert.
Ein vollständig saniertes Gebäude bietet bessere Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb. In diesem Fall kann mit zielgerichteten "kleineren" Maßnahmen wie dem Austausch konventioneller Heizkörper gegen Wärmepumpenheizköper eine hohe Effizienz der Wärmepumpe erreicht werden.
6. Bei Grundwasserwärmepumpe auf Genehmigung und Wasseranalyse achten
Für den optimalen und dauerhaft schadenfreien Betrieb von Grundwasser- bzw. Wasser-Wasser-Wärmepumpen müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Diese betreffen vor allem die Qualität des Grundwassers, das möglichst eisen- und manganarm sein sollte, um schädliche Ablagerungen in der Anlage zu vermeiden. Eine Grundwasseranalyse gibt hier Aufschluss. Auch die Höhe des Grundwasserspiegels ist zu beachten, denn bei Bohrungen tiefer als 20 Meter ist ein effizienter Betrieb meist nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist bei jeder Brunnenbohrung eine behördliche Genehmigung einzuholen. Zuständig ist die Untere Wasserbehörde der jeweiligen Landkreise, Regionen und kreisfreien Städte.
7. Bei Erdwärmepumpe auf ausreichenden Abstand der Kollektorrohre achten
Flächenkollektoren sollen gemäß VDI 4640 unterhalb der Frostgrenze in 1,2 bis 1,5 Meter Tiefe verlegt werden, wobei der Verlegeabstand in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser gewählt wird. Bei zu dicht verlegten Rohren wird dem Boden zu viel Wärme entzogen, was zu einer Vereisung des betreffenden Bereichs führen kann. Außerdem dürfen die Flächen über dem Kollektorfeld weder versiegelt noch überbaut werden. Um das Rohrsystem nicht zu beschädigen, sollten zudem keine tiefwurzelnden Bäume / Büsche angepflanzt werden.
8. Wärmepumpe nicht mit konventionellen Heizkörpern nutzen
Grundsätzlich können Wärmepumpen auch mit Heizkörpern effizient arbeiten. Dabei spielt allerdings die Art des Heizkörpers eine wichtige Rolle, denn "moderne" Plattenheizkörper sind eher geeignet als zum Beispiel Gliederheizkörper. Entscheidend ist nämlich ist die Art der Wärmeabgabe: Während Plattenheizkörper die Wärme über Strahlung abgeben, funktioniert die Wärmeabgabe bei Gliederheizkörpern über Konvektion. Dieses Prinzip der Wärmeübertragung ist eher ungeeignet für den Betrieb einer Wärmepumpe.
Am effizientesten arbeiten Wärmepumpen mit Flächenheizungen, also mit Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung. Da im Bestand die Installation einer Flächenheizung aber meist nicht möglich ist, ist die Umrüstung auf spezielle Wärmepumpenheizkörper eine gute Alternative, denn diese Heizkörper kommen mit relativ geringen Vorlauftemperaturen aus.
9. Bei innen aufgestellter Wärmepumpe Luftvolumenstrom richtig berechnen
Für den optimalen Betrieb benötigt eine im Innenbereich aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe einen bestimmten Luftvolumenstrom, der von der jeweiligen Leistung der Anlage abhängig ist. Werden die Querschnitte der Luftkanäle zu gering ausgelegt, kommt es zu Funktionsstörungen der Wärmepumpe.
10. Luftwärmepumpen benötigen Unterstützung für sichere Warmwasserbereitung
Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigen für die sichere Warmwassererzeugung technische Unterstützung. Eine Möglichkeit ist die zusätzliche Installation eines Spitzenlastkessels, der die Lastspitzen bei der Warmwasserbereitung abdeckt. Eine weitere Möglichkeit zur Erwärmung des (Trink-)Wassers besteht in der Nutzung von Solarthermie. Hierfür wird eine thermische Solaranlage auf dem Gebäudedach installiert. Wird das Wasser dagegen über einen elektrischen Heizstab erwärmt, so besteht die Möglichkeit, den dafür benötigten Strom über eine Photovoltaik-Anlage selbst zu erzeugen.
Eine grundsätzlich unproblematische (weil von den Außentemperaturen unabhängige) Möglichkeit zur Warmwassererzeugung ist der Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe. Diese nutzt als Wärmequelle das Grundwasser, dessen Temperaturen ganzjährig konstant bei rund 10° Celsius liegen.
Neben Komfortgründen sprechen auch gesundheitliche Aspekte für höhere Wassertemperaturen. So vermehren sich krankheitserregende Legionellen bevorzugt bei Temperaturen zwischen 25 und 45° Celsius, während bei höheren Temperaturen kaum noch bzw. keine Vermehrung mehr möglich ist.
Die komplette Kurzstudie "Die zehn häufigsten Fehler beim Neubau und der Sanierung von EFH und ZFH mit Wärmepumpen (vermeiden)" finden Sie hier.
Wie können Eigentümer:innen bei der Planung der Wärmepumpe unterstützen?
Eine gute Planung der Wärmepumpe gelingt nur, wenn auch die Bewohner:innen ihren Beitrag leisten. Dazu gehört die Klärung dieser Fragen und Punkte:
- detaillierte Erfassung des Gebäude-Ist-Zustands,
- die erforderliche / gewünschte / technisch mögliche Festlegung des Soll-Zustands,
- die genaue Definition und Beschreibung der beauftragten Leistungen in einer abgestimmten vertraglichen Vereinbarung, die alle Pflichten und Ansprüche definiert
- eine angemessene Honorierung / Bezahlung fachgerechter Leistungen
- die Beauftragung einer unabhängigen Bauqualitätssicherung als zusätzliche Kontrollinstanz, um mögliche Mängel rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen
- die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen, um sich mit der neuen Technik zu beschäftigen,
- die regelmäßige Wartung der Anlage
Weiterlesen:
--> Wärmepumpe im Altbau - funktioniert das?
--> Effizienter als gedacht: Wärmepumpe auch im Altbau zuverlässig
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Wärmepumpe
Produkte im Bereich Wärmepumpe
Sanierungsforum
-
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen » -
Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?
Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...
Antwort lesen » -
Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?
Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...
Antwort lesen » -
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung er Wärmepumpe in Anspruch nehmen. Sie ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn Sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.
Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?
Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen » -
Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?
Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...
Antwort lesen » -
Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?
Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...
Antwort lesen » -
Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?
Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...
Antwort lesen » -
Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?
Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...
Antwort lesen » -
Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?
Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...
Antwort lesen » -
Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?
Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?
In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...
Antwort lesen » -
Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?
Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...
Antwort lesen » -
Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?
Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...
Antwort lesen » -
Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?
Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...
Antwort lesen » -
Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?
Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort