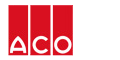Sanierung von Hochwasserschäden am Haus
Grundwissen für Besitzer von überfluteten Häusern
Gegen Naturgewalten wie Hochwasser sind Eigentümer:innen machtlos. Schnell sind Keller und Erdgeschoss überflutet, im schlimmsten Fall steht das Wasser noch höher. Wenn das Wasser erst läuft, findet es immer einen Weg in poröse Materialien, Hohlräume und Öffnungen – durch Wände, Decken, Fußböden. So nimmt die Bausubstanz starken Schaden. Grundwissen zur Sanierung von Hochwasserschäden im Überblick.
Neben dem schmerzlichen Verlust von Einrichtung und persönlichen Dingen wird spätestens nach dem Ablauf des Wassers deutlich, dass auch die Bausubstanz starken Schaden genommen hat. Zurückgelassen werden durchfeuchte, durchnässte und verschlammte Fußböden, Decken und Wände. Doch die Verschmutzung selbst ist noch das geringere Übel. Denn darüber hinaus bieten Schmutz und Feuchtigkeit den idealen Nährboden für Schimmelpilze und Bakterien. Das Hochwasser hat zudem eine Vielzahl von Keimen im Gepäck, der als mikrobieller Belag zurückgelassen wird. Aus diesem Grund müssen bei der Sanierung von Hochwasserschäden am Haus zahlreiche Aspekte beachtet werden - die einseitige Konzentration auf die Trocknung der feuchten Bauteile greift zu kurz. Um das umfangreiche Risikopotenzial richtig einschätzen zu können, ist die umfassende und fachlich versierte Einschätzung der Situation durch Sanierungsexperten enorm wichtig, damit die Sanierung der Hochwasserschäden erfolgreich ist.
Hochwasserschäden: Mehr als nur durchnässte Baustoffe
Erfahrungen aus der Sanierung herkömmlicher Wasserschäden helfen bei der Sanierung von Hochwasserschäden nur bedingt. Denn die massive Durchfeuchtung ganzer Gebäudekonstruktionen und über einen längeren Zeitraum kann mit Überflutungen nach starken Regenfällen und/oder Leitungswasserschäden nicht verglichen werden. Bei Hochwasser wirken große Kräfte, die zu einem Auftrieb von Gebäuden führen können. Wird die Auftriebskraft größer als die Summe aller Gebäudelasten, schwimmt das Gebäude im ungünstigsten Fall auf, was zu statischen Problemen an der Gebäudegründung oder innerhalb der Konstruktion führen kann. Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust. Befindet sich das Haus direkt am hochwasserführenden Fluss, kommt eine zusätzliche Belastung durch die Gewässerströmung hinzu. Gerade kleinere Gebäude mit einer geringen Gründungstiefe und/oder in erosionsgefährdeten Böden können dann mitgerissen und zum Einsturz gebracht werden. Treibgut im Hochwasser kann die Situation zusätzlich verschärfen und auch größere Häuser an ihre Grenzen führen. Das Unter- oder Ausspülen von Gebäuden kann darüber hinaus zu Hohlräumen und infolgedessen zu Setzungen führen.
Baustoffe reagieren verschieden auf Feuchtigkeit
Baustoffe und Bauteile, die im erdberührten Bereich ausgeführt werden (also im Keller- und Sockelbereich), sind grundsätzlich für eine dauerhafte Feuchtebelastung ausgelegt. Für Baustoffe und Bauteile der Fassade oder des Erdgeschosses gilt das nicht. Infolgedessen reagieren die dort verwendeten Materialien anders auf eine starke Durchfeuchtung durch Hochwasser. Einige Baustoffe sind noch nicht einmal für eine kurzzeitige Durchfeuchtung ausgelegt, geschweige denn für eine massive und längere Durchfeuchtung. Dem entsprechend muss man unterscheiden zwischen Baustoffen, die stark durchfeuchtet sind und einfach getrocknet werden können, und Baustoffen, die kaum getrocknet werden können oder nur sehr schwer und über einen längeren Zeitraum zu trocknen sind. Wieder andere Baustoffe sind nach einem Hochwasser so beschädigt oder durchweicht, dass sie komplett rückgebaut und entsorgt werden müssen.
--> Weiterlesen:
- Verhalten von Baustoffen bei Hochwasser: Tipps für Massivhaus, Fertighaus, Altbau und Fachwerkhaus
- Verhalten von Dämmstoffen bei Hochwasser
Hochwasser hinterlässt starke Verschmutzung
Noch ein Problem: Das Hochwasser hinterlässt eine starke Verschmutzung unbekannter Herkunft und Zusammensetzung. Ein Punkt, der bei einer zu schnellen und unüberlegten Sanierung langfristige und angenehme Folgen für die Bewohner haben kann. Deshalb muss die Trocknung nasser Häuser auch unter mikrobiellen Gesichtspunkten gesehen werden. Schließlich überschwemmt das Hochwasser auch landwirtschaftliche Felder und wäscht Pestizide, Herbizide und Fungizide aus. Außerdem werden Fäkalien aus überfluteten Kläranlagen, Toilettenanlagen und Tierställen mitgeführt, wie auch Keime aus Abwasserleitungen oder mitgeführten Tierkadavern. Hinzu kommen Chemikalien aus überschwemmten Industrieanlagen sowie Heizöle und Kraftstoff aus Kellern, Garagen, Heizungsanlagen und Tankstellen.
So verständlich es auch ist, dass vom Hochwasser betroffene Eigentümer:innen die Sanierung der Schäden so schnell wie möglich erledigen wollen – Konzepte von der Stange gibt es leider keine. Für eine differenzierte Schadensanalyse (physikalische, chemische und mikrobiologische Schadensprozesse) und das Erstellen eines Sanierungskonzeptes durch Sachverständige sollten sie sich Zeit nehmen. Und danach die Sanierung der Hochwasserschäden zügig in Angriff nehmen.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Kellersanierung
Produkte im Bereich Kellersanierung
Sanierungsforum
-
Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?
Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...
Antwort lesen » -
Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?
Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...
Antwort lesen » -
Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?
Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...
Antwort lesen » -
Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?
Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?
Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...
Antwort lesen » -
Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?
Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...
Antwort lesen » -
Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?
Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...
Antwort lesen » -
Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?
Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...
Antwort lesen » -
Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?
Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?
Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?
Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...
Antwort lesen » -
Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?
Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...
Antwort lesen » -
Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?
Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...
Antwort lesen » -
Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?
Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...
Antwort lesen » -
Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?
Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...
Antwort lesen » -
Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?
Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...
Antwort lesen » -
Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?
Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich den Zuschuss zum Heizungstausch, wenn ich die Öltanks verkaufe?
Sie können die Förderung der neuen Heizung auch beantragen, wenn Sie die Öltanks verkaufen. Möchten Sie den Bonus zum Heizungstausch ...
Antwort lesen » -
Muss nach der Installation der Wärmepumpe die alte Gasheizung ausgebaut werden oder reicht die Abmeldung vom Gasbetreiber?
Das hängt von der Förderung der Wärmepumpe ab. Haben Sie keine Fördermittel oder nur die Basis-Förderung beantragt, können Sie die ...
Antwort lesen » -
Gelten die Ausnahmen von der GEG-Austauschpflicht für Heizungen für Öl- und Gasheizungen?
Die Ausnahmen von der Austauschpflicht für Heizungen im GEG für Niedertemperatur- und Brennwertheizungen gelten sowohl für Öl- als auch für ...
Antwort lesen » -
Darf auch ein Fachunternehmen Fachplanung und Baubegleitung übernehmen?
Bei einem geförderten Heizungstausch kann auch die Fachfirma die Arbeiten planen und überwachen. Zudem sind Fachunternehmer in diesem Fall ...
Antwort lesen » -
Lohnt sich die Kellerdeckendämmung?
Ist der Keller unbeheizt, geht weniger Wärme aus dem Erdgeschoss an diesen verloren. Das reduziert zum einen die Energiekosten. Zum anderen ...
Antwort lesen » -
Darf ich die Förderung der Sanierung jedes Jahr erneut beantragen?
Das ist möglich. Relevant ist nicht, wann Sie die Arbeiten umsetzen, sondern in welchem Kalenderjahr Sie diese beantragen. Beachten Sie ...
Antwort lesen » -
Kann ich die Photovoltaikanlage bei der Förderung der Biomasseheizung angeben, auch wenn diese nicht mir gehört?
Wenn Ihnen der Strom der PV-Anlage zur Verfügung steht (Mietanlage) und der Ertrag ausreicht, um den Energiebedarf der Warmwasserbereitung ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Förderung für die Dachsanierung?
Eine Förderung für die Dachsanierung erhalten Sie über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), den Steuerbonus für die Sanierung ...
Antwort lesen » -
Wie hoch ist die Förderung eines Fernwärmeanschlusses?
Für den Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz bekommen Sie Zuschüsse in Höhe von 30 Prozent der Kosten. Nach Rücksprache mit der KfW ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich die Förderung für eine neue Heizung ohne Entsorgungsnachweis für die alte Ölheizung?
In diesem Fall bekommen Sie zwar die Förderung der neuen Heizung. Den Geschwindigkeitsbonus erhalten Sie jedoch nicht. Denn dieser setzt ...
Antwort lesen » -
Kann ich an der Traufe des Reihenmittelhauses einen Schornstein anbringen?
Hier gelten die Ableitbedingungen für Schornsteine aus der 1. BImSchV (Absatz 2 aus § 19 der 1. BImSchV). Die Austrittsöffnung muss demnach ...
Antwort lesen » -
Mussten wir die alte Ölheizung bereits austauschen? Welche Möglichkeiten haben wir heute?
Während Alteigentümer in vielen Fällen von der Austauschpflicht im GEG befreit sind, greift diese nach einem Eigentumsübergang. Die neuen ...
Antwort lesen » -
Kann ich eine bestehende Dämmung bei der Dämmpflicht an der obersten Geschossdecke anrechnen?
Ja, das ist möglich. Denn das GEG fordert hier einen bestimmten U-Wert. Diesen erreichen Sie immer mit dem gesamten Bauteilaufbau (neu und ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort