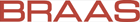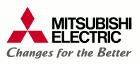Sanierungstipps für jedes Baujahr - 50er bis 90er Jahre
Typische Schwachstellen und Bauweisen
Mehr als 40 Prozent der Wohnungen in Deutschland wurden zwischen 1950 und 1977 erbaut – und damit vor der ersten Wärmeschutzverordnung. In diesen Häusern und Wohnungen können Eigentümer mit einer Sanierung besonders viel Energie einsparen. Experten kennen zudem die typischen Schwachstellen bei Immobilien der verschiedenen Jahrgänge. Hier finden Sie Altbau-Sanierungstipps für jedes Baujahr.
Die 50er-Jahre: Enger Grundriss, Probleme mit Schimmel
In der Nachkriegszeit musste es vor allem schnell gehen: Oft sind die Grundrisse beengt, die Bauweise ist sehr einfach. Auch mangelhafte Baumaterialien kommen zum Einsatz. Eine Ofenheizung ist noch die Regel, die Elektrik unzureichend. Schall- und Wärmedämmung spielen noch keine Rolle, beides wurde später entweder unzureichend nachgerüstet oder fehlt nach wie vor. Das schränkt den Wohnkomfort teils erheblich ein. Auch Wärmebrücken innerhalb der Konstruktion treten häufig auf. Die Folgen: ein zu hoher Energiebedarf und zu viel Feuchtigkeit, was zu Schimmel führen kann.
Sanierungstipps für die 50er Jahre: Bei einer Sanierung sollten die verarbeiteten Materialien genau überprüft, bei Bedarf ersetzt und bauliche Mängel sorgfältig behoben werden. In den typischen Siedlungshäusern stehen besonders Feuchtigkeitsschäden, Haustechnik und Dacheindeckung im Fokus. Weitere wichtige Punkte sind Heizung sowie Tritt- und Schallschutz. Um die Wohnfläche zu erweitern, bietet sich teilweise ein Anbau an.
Die 60er-Jahre: Mehr Wohnfläche, fehlende Dämmung
Für die Häuser aus den 60er-Jahren ist die unzureichende Wärme- und Schalldämmung charakteristisch. Dazu kommen Probleme mit mangelhaften, veralteten oder schadstoffbelasteten Baustoffen. Weitere Schwachstellen liegen in der Konstruktion und betreffen tragende Wände, Treppen, Brüstungen und Geländer. Die Sanitär-, Elektro- und Heizungsanlagen aus diesem Jahrzehnt sind in der Regel technisch veraltet. Insgesamt ist die Qualität der Wohnbauten jedoch schon gut. Die Räume sind großzügiger geschnitten und bieten Fensterfronten.
Sanierungstipps für die 60er Jahre: Auf dem Sanierungsplan stehen eine Senkung des Energieverbrauchs durch Dach- und Fassadendämmung, Prüfen von Schäden an konstruktiven Bauteilen, Ersetzen der Wasser- und Entwässerungsleitungen, Erneuern der Heizung und der Fenster. Außerdem ist eine Badsanierung sinnvoll.
Die 70er-Jahre: Erste Dämmung, viele Schadstoffe
Gebaut wird in diesen Jahren vor allem mit Beton. Die Elektro- und Sanitärinstallationen seit den 70er-Jahren sind aus heutiger Sicht noch zeitgemäß. Nach der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 wird erstmals gedämmt, allerdings entspricht diese Dämmung nicht mehr den heutigen Standards. Häufig gibt es Probleme mit Feuchtigkeit im Bodenbereich. Wenig komfortabel und klein sind oft auch die Bäder, in vielen Reihenhaussiedlungen gibt es im Bad kein Tageslicht. Die Zahl der verbauten Schadstoffe nimmt zu.
Sanierungstipps für die 70er Jahre: Bei dieser Baugeneration sollte bei der Sanierung besonders auf Schadstoffe wie Asbest und Holzschutzmittel sowie Feuchtigkeitsschäden geachtet werden. Häufig gibt es Schwachstellen an Dach und Außenwänden. Daher stehen auch hier oft Dach- und Fassadendämmung sowie die Erneuerung der Heizung an. Dagegen sind die damals häufig verbauten Mahagoniholzfenster bei guter Wartung und bereits verwendeter Zweifachverglasung oft noch nicht am Ende ihres Lebenszyklus. Ein Austausch ist daher nicht automatisch notwendig.
Was kostet eine Sanierung? Hier können Sie kostenfrei und unverbindlich Vergleichsangebote einholen.
Die 80er-Jahre: Ausgebautes Dachgeschoss, Schwachstelle Dachterrasse
Mit steigenden Anforderungen an die Wärmedämmung ersetzt das Warmdach mit seiner Dämmschicht in den 80er-Jahren häufiger das in den Jahrzehnten davor gängige Kaltdach. Ein Vorteil: Bislang als Stauraum oder Wäscheboden genutzte Dachgeschosse werden zur Wohnfläche und sind baulich entsprechend ausgestattet. Die häufiger auftretende Dachterrasse erweist sich allerdings oft als Schwachstelle bei starkem Regen sowie starker Sonneneinstrahlung. Weitere Schwachstellen sind bei dieser Gebäudegeneration häufig Erdgeschossaußenwände und Wohnungstrennwände, Fensterleibung und Rollladenkästen. Wichtig bleibt die Überprüfung von gesundheitsbelastenden Materialien, allen voran asbesthaltige Dachplatten oder Fassadenplatten, Mineralwolle mit zu geringer Faserlänge, gesundheitsschädliche Holzschutzmittel sowie formaldehydhaltige Spanplatten und andere Holzbaustoffe.
Sanierungstipps für die 80er Jahre: Eine genaue Prüfung lohnt sich bei den Warmdächern aus dieser Zeit, da sie häufig noch Baumängel aufweisen. Oft sind die Dampfsperren falsch verbaut oder verschlissen. Dadurch dringt Feuchtigkeit ein. Häuser aus den 1980er-Jahren sind aufgrund der Mängel bei Wärmeschutz und Luftdichtheit energetisch in immer noch fragwürdigem Zustand. Allerdings sind die eingesetzten Bauteile meist noch so gut in Schuss, dass eine Erneuerung aus wirtschaftlicher Sicht wenig Sinn macht. Wo Einsparpotenzial liegt, kann ein Energieberater beurteilen.
Die 90er-Jahre: Fassadendämmung kommt, Dach auf Feuchteschäden prüfen
In den 90er Jahren rückt die Reduzierung der CO2-Emissionen in den Blickpunkt – auch bei Bestandsimmobilien. Die Politik errichtet mit einer novellierten Wärmeschutzverordnung das Fundament für energiebewusste Baumaßnahmen: Das Energieeinsparen tritt in den Vordergrund – es werden immer mehr Passiv- und Niedrigenergiehäuser gebaut. Fassaden erhalten eine Dämmung, meist aus Polystyrol. Zunehmend werden Systeme eingebaut, die erneuerbare Energie nutzen.
Sanierungstipps für die 90er Jahre: Die Dämmung dieser Gebäude ist aus heutiger Sicht oft nicht mehr ausreichend. Die Baustoffe befinden sich aber noch mitten in ihrem Lebenszyklus, wenn sie ordentlich verbaut worden sind. Trotzdem sind auch hier mögliche Feuchtigkeitsschäden ein zentraler Prüfpunkt, vor allem am Dach.
Grundsätzlich gilt bei einer Sanierung für Häuser aller Baujahre: Zu Beginn ist eine Energieberatung mit Sanierungsfahrplan sinnvoll! Denn die richtige Reihenfolge der einzelnen Gewerke entscheidet mit über den Erfolg und den damit gewonnenen Wohnkomfort.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Ratgeber Sanierungsplanung
Produkte im Bereich Ratgeber Sanierungsplanung
Sanierungsforum
-
Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?
Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...
Antwort lesen » -
Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?
In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...
Antwort lesen » -
Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?
Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...
Antwort lesen » -
Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?
Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?
Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...
Antwort lesen » -
Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?
Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...
Antwort lesen » -
Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?
Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?
In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?
Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?
In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...
Antwort lesen » -
Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?
Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen » -
Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?
Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...
Antwort lesen » -
Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?
Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...
Antwort lesen » -
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.
Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?
Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort