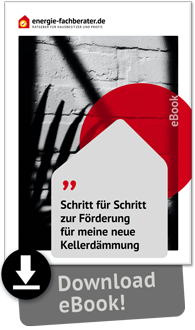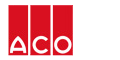Technische Bautrocknung nach Wasserschäden
Verfahren zur Trocknung von Baustoffen - ein Überblick
Ob begleitende Maßnahme bei der Kellersanierung oder Sanierung von Wasserschäden – die technische Bautrocknung beschleunigt die Trocknung von Beschichtungen und reduziert den Feuchtegehalt im Mauerwerk sowie in Baustoffen. Ein Überblick zu den verschiedenen Verfahren wie Raumtrocknung, Dämmschichttrocknung und Estrichtrocknung.
Zu den sporadischen Wasserschäden gehören Durchfeuchtungen der gesamten Bauwerkskonstruktion in Folge von starken Niederschlägen oder Hochwasser, Leitungswasserschäden (z. B. Wasserzu- und/ oder -ableitungen, Heizungen), geplatzten Wasserschläuchen an Waschmaschinen oder Geschirrspülern, so genannten Havarieschäden wie z. B. geplatzte Aquarien, übergelaufene Badewannen, Toiletten oder Waschbecken, fehlende oder defekte Rückstausicherungen sowie Löschwasser in Folge einer Brandschadensanierung.
Technische Bautrocknung bei Wasserschäden
Grundsätzlich sind bei der technischen Bautrocknung zwei wichtige Aspekte zu beachten:
Zum Einen handelt es sich in den seltensten Fällen um kompakte, homogene Baustoffe, die zu trocknen sind, sondern um miteinander verbaute Verbundbaustoffe, deren Komponenten in der Regel ein unterschiedliches Wasseraufnahme- und Austrocknungsverhalten haben. Aufgrund dieser unterschiedlichen Materialeigenschaften können im Verbundbaustoff durch behinderte Schrumpf- und Schwindvorgänge Spannungen induziert werden, die zu Rissen, Abplatzungen oder Ablösungen führen können.
Zum Anderen werden mit der technischen Bautrocknung die Primärursachen der Durchfeuchtung nicht beseitigt, sondern nur die Auswirkungen. Diese meistens auch zeitversetzt, so dass der Grad der Durchfeuchtung und eventuell das Wachstum von Mikroorganismen (biologischer Schadensprozess) nicht sofort erkennbar sind. Ein besonderes Risiko sind Hohlräume und schwimmende Estriche, weil eine Durchfeuchtung in diesem Bereich zur Ansammlung stehenden Wassers führt, das sich unter der Dämmung ausbreiten kann. Das Problem besteht darin, dass die Ansiedlung und das Auskeimen von Mikroorganismen meist unbemerkt bleiben und erst sehr viel später erkannt werden. Deshalb ist zu beachten, dass die fehlerhafte Anwendung des "richtigen" Verfahrens unter Umständen eine erhebliche Gesundheitsbelastung für die Bewohner verursachen kann.
Je nachdem, welche Teile eines Hauses oder eines Bauteils durchfeuchtet wurden, kann bei der Trocknung zwischen Raumtrocknung, Dämmschichttrocknung und Estrichtrocknung unterschieden werden.
Raumtrocknung
Eine Raumtrocknung wird bei Wohnungen nach einem Wasserschaden, in unbewohnten Räumen während der Rohbauphase (Neubau) oder nach einer Sanierung (Altbau) durchgeführt, um die in Folge der Feuchteabgabe durchnässter oder durchfeuchteter Bauteile ("Baufeuchte") an die Raumluft erhöhte Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Verwendet werden in der Regel Kondenstrockner oder (Ad-)Sorptionstrockner.
Dämmschichttrocknung
Die Dämmschichttrocknung kommt in der Regel in unbewohnten Wohnungen zur Anwendung, wenn Wärme- und Trittschalldämmungen (horizontale Flächen), Ausgleichsschüttungen jeglicher Art oder Wärmedämmungen in Außenwandkonstruktionen oder Trennwänden (vertikale Flächen) zu trocknen oder zu entfeuchten sind. Die überwiegende Mehrheit der Dämmschichttrocknungen erfolgt mittlerweile mit Hochleistungsverdichtern in schallgedämpfter Ausführung in Verbindung mit Kondenstrocknern oder (Ad-)Sorptionstrocknern. Am Markt werden zwei verschiedene Technologien angeboten: das Überdruck- und das Unterdruckverfahren.
Wird nach frühzeitiger Feststellung eines Wasserschadens innerhalb von Stunden die Ursache beseitigt, kann ein Bodenaufbau mit dem Überdruckverfahren getrocknet werden. Handelt es sich dagegen um einen länger zurückliegenden Wasserschaden oder einen Schaden, bei dem fäkalienverunreinigte Abwässer ausgetreten sind, muss zwingend das Unterdruckverfahren eingesetzt werden. Die Leistungsfähigkeit des Überdruckverfahrens ist im Vergleich zum Unterdruckverfahren zwar um 20 bis 30 Prozent höher. Andererseits wird beim Überdruckverfahren die Raumluft durch Staub, Sporen und andere mikrobielle Partikel belastet. Um eine Staubbelastung zu vermeiden, empfiehlt sich beim Vakuumverfahren der Einsatz von Mikrofiltern. Um eine mikrobielle Belastung zu vermeiden, werden so genannte HEPA-Filter verwendet.
Estrichtrocknung
Zur Trocknung von Estrichen und der darunterliegenden Trittschalldämmung wird die zerstörungsarme Estrichtrocknung angewendet, indem trockene Luft unter Druck unter den Estrich in die Dämmung geführt wird. Die Luft entzieht dem Material die Feuchtigkeit und transportiert sie nach außen. In der Regel wird die trockene Luft mit einem Hochdruckverdichter in die Dämmung eingeblasen und entweicht über die Randfugen oder im Einzelfall über gezielt gesetzte Bohrlöcher. Die Trocknung der Luft kann sowohl mit Kondenstrocknern als auch mit (Ad-)Sorptionstrocknern erfolgen. Um die Entfeuchtung neuer Estriche zu beschleunigen, sollten diese eine raue Oberfläche aufweisen. Die zu trocknenden Flächen müssen frei zugänglich und staubfrei sein und sich in einem geschlossenen Raum befinden (Türen und Fenster verschließen). Die Trocknungsdauer ist von der Art, von der Dicke und vom vorhandenen Feuchtegehalt des Estrichs abhängig und kann durch Zusatzmittel im Estrich beschleunigt oder verzögert werden.
Alternativ kann die trockene Raumluft mit Vakuumpumpen über die Randfugen bzw. gezielt gesetzte Bohrlöcher durch die Dämmschicht gesaugt und im befeuchteten Zustand abgeleitet werden. Dieses Verfahren bietet sich an, wenn die Dämmschicht lose geschüttetes Material oder Mineralfasern enthält, die beim Druckverfahren aufgewirbelt werden können. Durch den Einsatz spezieller Mikro- und/ oder HEPA-Filter kann eine gesundheitliche Belastung für die Bewohner verhindert werden.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Kellersanierung
Produkte im Bereich Kellersanierung
Sanierungsforum
-
Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?
Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...
Antwort lesen » -
Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?
In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...
Antwort lesen » -
Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?
Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...
Antwort lesen » -
Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?
Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?
Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...
Antwort lesen » -
Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?
Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...
Antwort lesen » -
Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?
Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?
In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?
Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?
In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...
Antwort lesen » -
Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?
Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen » -
Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?
Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...
Antwort lesen » -
Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?
Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...
Antwort lesen » -
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.
Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?
Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort