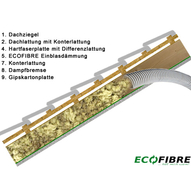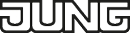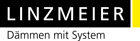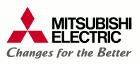Wie funktioniert eigentlich eine Sonnenschutzverglasung?
Beschichtete und schaltbare Verglasungen sperren Hitze aus
Heiße Tage, warme und schlaflose Nächte - gegen zu warme Wohnräume ist Sonnenschutz unerlässlich. Neben außen vor dem Fenster angebrachten oder im Innenraum befindlichen Sonnenschutzlösungen kann auch eine Sonnenschutzverglasung gute Dienste leisten. Moderne Sonnenschutzverglasungen sorgen für angenehmere Temperaturen in den Wohnräumen - aber wie funktioniert das eigentlich? Wir stellen drei Varianten vor.
Um Hitze aus Wohnräumen fernzuhalten, sind drei verschiedene Varianten bei den Sonnenschutz-Verglasungen erhältlich: Sonnenschutzgläser mit Beschichtung, schaltbare Verglasungen und Systeme im Scheibenzwischenraum. Sie helfen, die Aufheizung zu reduzieren und tragen zu angenehmen Temperaturen im Innenraum bei. Das spart auch Energie, denn es muss weniger gekühlt werden.
Sonnenschutz mit beschichteter Verglasung
Eine beschichtete Sonnenschutzverglasungen ist farbneutral und besitzt nahezu keine spiegelnden Eigenschaften. So sieht sie aus wie eine ganz normale Fensterverglasung. Zudem lässt sie viel gesundes Tageslicht, aber bis zu 80 Prozent weniger den Raum aufheizende, infrarote Wärmestrahlung hinein – eine Kombination, die für einen besonders hohen Wohnkomfort im Sommer sorgt.
Sonnenschutz mit schaltbarer Verglasung
Eine zweite Variante der Sonnenschutzverglasung sind schaltbare oder dimmbare Verglasungen. Der Vorteil: Bei solchen Fenstern lässt sich in mehreren Schritten die Farbe von glasklar hin zu einem angenehmen Blau verändern, und zwar durch Zugabe von elektrischem Strom. So wird der Energieeintrag der Sonne reduziert und gleichzeitig bleibt die Durchsicht erhalten. Solche sogenannten elektrochromen Verglasungen sind zum Beispiel als Dachfenster erhältlich.
Weniger dem Schutz vor der Sonne als dem Schutz vor neugierigen Blicken dienen Verglasungen, die sich mit Strom von durchsichtig auf undurchsichtig umschalten lassen. Hierbei wird der Energieeintrag kaum reduziert und auch die Durchsicht nach draußen entfällt vollständig.
Sonnenschutzsysteme im Scheibenzwischenraum
Bei Sonnenschutzsystemen im Scheibenzwischenraum werden unter anderem Jalousien, Rollos oder Plissees ohne Verschmutzungsgefahr in die Verglasung integriert, die manuell bedient oder über eine Fernbedienung gesteuert werden können. So lässt sich genau einstellen, wie viel Sonne in den Raum hineindarf und in welchem Umfang der Blick nach draußen erhalten bleibt. Auch für mehr Privatsphäre können diese Systeme sorgen – neugierige Blicke bleiben draußen.
Vorteile einer Sonnenschutzverglasung
Gerade bei großflächigen Verglasungen nach Süden lohnt es sich, über eine Sonnenschutzverglasung nachzudenken. Die Räume sind so leichter kühl zu halten. Außerdem muss kein außenliegender Sonnenschutz an der Fassade eingeplant werden. Damit sind EigentümerInnen unabhängiger bei der Planung, zum Beispiel bei einer Sanierung oder im Denkmalschutz.
Nachteile einer Sonnenschutzverglasung
Nachteile kann eine Sonnenschutzverglasung zum Beispiel im Winter haben. Um Heizkosten zu sparen, sind Wärmegewinne durch die Sonne dann durchaus erwünscht. Durch die konstante Reflexion des Sonnenlichts ist das bei einer Sonnenschtzverglasung aber kaum möglich. Auch Tageslicht geht für den Innenraum verloren.
Wer das verhindern möchte, sollte auf eine schaltbare Sonnenschutzverglasung setzen, denn diese ist flexibler als eine beschichtete Verglasung. Einziger Wermutstropfen: Solche elektrochromen Verglasungen sind noch nicht lange auf dem Markt, so dass Langzeiterfahrungen fehlen.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Ratgeber Hitzeschutz
Produkte im Bereich Ratgeber Hitzeschutz
Sanierungsforum
-
Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?
Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...
Antwort lesen » -
Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?
In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...
Antwort lesen » -
Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?
Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...
Antwort lesen » -
Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?
Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?
Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...
Antwort lesen » -
Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?
Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...
Antwort lesen » -
Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?
Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?
In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?
Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?
In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...
Antwort lesen » -
Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?
Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen » -
Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?
Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...
Antwort lesen » -
Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?
Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...
Antwort lesen » -
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.
Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?
Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort





 Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden
Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden