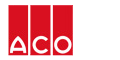Sanierung von Hochwasserschäden: Schadensprozesse bei Baustoffen
Verschiedene Schadensprozesse überlagern sich
Welche Schäden nach einem Hochwasser am Haus auftreten, hängt von den verbauten Baustoffen ab. Besondere Beachtung verdienen mehrschichtige Aufbauten aus verschiedenen Baustoffen und Hohlräume, wo Probleme manchmal erst viel später bemerkt werden. Auf diese Stellen und Baustoffe sollten die Eigentümer:innen überfluteter Häuser besonderes Augenmerk legen.
Physikalische Schadensprozesse sind auf das Quellverhalten vieler Materialien beziehungsweise irreversible Verformungen zurück zu führen. Sie setzen bei Hochwasser in der Regel sofort ein. Die Folge sind Zugspannungen, die zu Rissen, Abplatzungen und Ablösungserscheinungen führen. Bei Holz (Parkett, Schwingböden, Paneele, Türen, Möbel etc.) sind solche Schäden besonders gravierend. Schon in den ersten Tagen nach dem Hochwasser können irreparable Schäden auftreten.
Chemische Schadensprozesse im Haus nach Hochwasser
Chemische Schadensprozesse sind stark abhängig von der Art des betroffenen Materials. Die Stahlkorrosion nimmt bei Anwesenheit von Schadstoffen ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent exponentiell zu. Die Zersetzung von Teppich- und Papierklebern setzt bereits nach wenigen Stunden ein und verursacht irreparable Schäden. Anhydrid, Gips und gipshaltige Baustoffe dekristallisieren nach wenigen Tagen und verlieren so ihre Festigkeit. Da diese Baustoffe ohnehin keine Wasserfestigkeit aufweisen, müssen sie im Rahmen der Hochwasser-Sanierung ohnehin ausgebaut werden. Ausblühungen hingegen treten oft erst Wochen oder Monate nach der Trocknung auf. Bei Holzwerkstoffen kann die Durchfeuchtung unter Umständen auch zur verstärkten Freisetzung von Formaldehyd führen. Aus durchfeuchteten Klebern oder Dämmstoffen können VOC (flüchtige organische Verbindungen) freigesetzt werden, auf die sensible Menschen mit gesundheitlichen Problemen reagieren.
Problemfall Parkettboden
Ein besonderes Problem sind Parkettböden. Da ist zu klären, ob sie mit dem Untergrund verklebt sind. Schwimmend verlegte Mehrschichtplatten sind gesondert zu bewerten. Bei geklebten Parkettböden ist konstruktionsbedingt durch die technische Bautrocknung (mit Kondenstrockner oder (Ad-)Sorptionstrockner) mit Abrissfugen zu rechnen, so dass die Funktionstauglichkeit der Böden nicht mehr gegeben ist. Bei einem schwimmend verlegten Bodenaufbau sind feuchtigkeitsbedingte irreversible Verformungen (Schüsselungen) deutlich stärker ausgeprägt als bei einem vollflächig verklebten Parkettboden. Eine Sanierung des Bodens ist auch bei intakter Nut- und Feder-Verbindung in der Regel nicht mehr möglich. In dem Fall kommt nur ein kompletter Rückbau in Frage. Bei stehendem Wasser wölben sich Parkettböden auf und zeigen erhebliche Quellerscheinungen. Weist der Estrich Risse oder eine weiche Oberfläche auf, muss auch der komplette Estrichaufbau entfernt werden.
Problematische Bereiche nach Hochwasserschäden
Das Hauptproblem bei Hochwasserschäden besteht darin, dass nicht nur die Oberfläche durchfeuchtet ist, sondern beispielsweise auch die Dämmschicht unter dem Estrich. Wasser, das unter die Dämmschicht eingedrungen ist und sich dort verteilt hat, kann auf normalem Wege nicht austrocknen, so dass eine spezielle Dämmschichttrocknung erforderlich ist. Besonders problematisch sind Hohlräume und schwimmende Estriche, weil eine Durchfeuchtung in diesem Bereich zur Ansammlung von stehendem Wasser führt, das sich unter der Dämmschicht ausbreiten kann. Die folgende Ansiedlung und das Auskeimen von Mikroorganismen bleibt hier meist unbemerkt und kann oft erst sehr viel später erkannt werden. Gleiches gilt, wenn ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) hinterfeuchtet wurde. Je nachdem, welcher Dämmstoff und ob eine mineralische Verklebung oder ein Dispersions- oder PU-Harzkleber verwendet wurde, muss das WDVS komplett rückgebaut werden.
--> Weiterlesen: Verhalten von Dämmstoffen bei Hochwasser
Technische Bautrocknung bei Hochwasserschäden
Grundsätzlich muss bei der technischen Bautrocknung beachtet werden, dass es sich in den seltensten Fällen um kompakte, homogene Baustoffe handelt, die zu trocknen sind, sondern um miteinander verbaute Verbundbaustoffe, deren Komponenten in der Regel ein unterschiedliches Wasseraufnahme- und Austrocknungsverhalten haben. Aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften können im Verbundbaustoff durch behinderte Schrumpf- und Schwindvorgänge Spannungen induziert werden, die zu Rissen, Abplatzungen oder Ablösungen führen können. Selbst wenn eine Trocknung also sichergestellt werden kann, ist es nicht auszuschließen, dass als Folgeerscheinung der Trocknung nachgelagerte Bauschäden auftreten können.
Biologische Schadensprozesse bei Hochwasserschäden: Schimmelbefall
Schimmelpilze und Bakterien werden oft sowohl in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit als auch in ihren Konsequenzen unterschätzt. Die Folgen der durch Mikroorganismen verursachten biologischen Schadensprozesse reichen einerseits von optischen Beeinträchtigungen bis hin zur vollständigen Materialzerstörung und andererseits von Geruchsbelästigungen bis zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Die Entwicklung von Schimmelpilzbefall beginnt anfangs unsichtbar schon nach circa 36 bis 48 Stunden. Wärme und erhöhte Luftfeuchtigkeit können diesen Prozess erheblich beschleunigen. Nicht entdeckte oder nicht beseitigte Materialfeuchtigkeit bereitet zusätzlich den Nährboden für einen späteren Schädlingsbefall. Biologische Schadensprozesse können in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren wie zum Beispiel Feuchtigkeit, Temperatur, pH-Wert, Nährstoffangebote etc. auch auf der Oberfläche von anorganischen Stoffen einsetzen. Die oft geäußerte Aussage, dass nur organische Stoffe von Schimmelpilz- und Bakterienbefall betroffen sein können, ist dem zu Folge unzutreffend.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Innenausbau
Produkte im Bereich Innenausbau
Sanierungsforum
-
Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?
Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...
Antwort lesen » -
Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?
In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...
Antwort lesen » -
Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?
Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...
Antwort lesen » -
Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?
Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?
Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...
Antwort lesen » -
Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?
Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...
Antwort lesen » -
Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?
Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?
In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?
Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?
In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...
Antwort lesen » -
Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?
Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen » -
Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?
Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...
Antwort lesen » -
Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?
Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...
Antwort lesen » -
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.
Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?
Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort