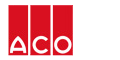Verhalten von Dämmstoffen bei Hochwasser
Wasserschaden an der Dämmung sanieren
Viele Eigentümer.innen stehen nach einem Hochwasser vor der Frage, ob ihre gedämmten Kellerwände, Kellerdecken und Außenwände durch das Hochwasser so geschädigt wurden, dass die Dämmung entfernt werden muss. Doch für die meisten Dämmstoffe sind keine Probleme zu erwarten. Nur bei wenigen Dämmstoffen muss die Dämmung aufgrund eines Wasserschadens entfernt und neu eingebaut werden.
Ein Hochwasser betrifft bei einem Großteil der Häuser Keller, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss. In Mitleidenschaft gezogen sind also in den meisten Fällen die Dämmung der Außenwände, gedämmte Kellerdecken und Fußbodendämmungen und Trittschalldämmungen unter Estrichen. Doch wie schlimm ist so ein Wasserschaden? Ob die Dämmung nach Rückgang des Hochwassers erneuert werden muss, hängt aber nicht nur vom verbauten Dämmstoff ab. Ebenso muss der Grad der Beschädigung der Dämmstoffstruktur und der Verunreinigung, die nach der Austrocknung verbleibt, berücksichtigt werden.
Was passiert mit Dämmstoffen im Hochwasser?
Die meisten Dämmstoffe haben in ihrer Struktur große und kleine Hohlräume - Poren oder Zellen - die mit Luft oder Zellgas gefüllt sind. Zudem gibt es bei einigen Dämmstoffen auch feine Kanäle, so genannte Kapillaren, in denen Wasser besonders gut transportiert wird und sogar nach oben steigen kann. Bei Hochwasser dringt Wasser in diese Materialien ein und verdrängt die Luft aus den Hohlräumen. Je nach der Größe der Poren und Kapillaren geht das unterschiedlich schnell. Große Hohlräume füllen sich deutlich schneller mit Wasser als kleine. Allgemein gilt: Je poröser ein Material ist, desto mehr Wasser kann es in seinem Porenraum aufnehmen. Einige Dämmstoffe (extrudiertes Polystyrol (XPS), Polyurethan (PU) und Schaumglas (CG)), weisen überwiegend geschlossene Zellen auf, in denen sich Zellgas zur Verbesserung der Dämmeigenschaften befindet. Diese Stoffe nehmen trotz großen Porenraums kein oder nur sehr wenig Wasser auf, da die geschlossenen Zellwände das Ausdiffundieren der Zellgase verhindern und umgekehrt dann natürlich auch kein Wasser hineinlassen.
Welche Schäden sind an der Dämmung zu erwarten?
Für alle feuchten oder nassen Dämmstoffe gilt, dass die Dämmung einen schlechteren Wärmeschutz bietet, als im trockenen Zustand. Nehmen harte Dämmplatten Feuchte auf, können sie quellen und es kann zu Rissbildung bei angrenzenden Baustoffschichten kommen. Dämmstoffe, die für Anwendungen im Erdreich und am Sockel des Hauses konstruiert wurden, so genannte Perimeterdämmungen, werden im Zulassungsverfahren auf Wasseraufnahme bei teilweisem oder vollständigem Eintauchen getestet. Nur wenn sie kein - oder nur sehr wenig - Wasser aufnehmen, bekommen sie eine bauaufsichtliche Zulassung für diesen Einsatzbereich. Bei solchen Dämmstoffen sind keine Wasserschäden an der Dämmung durch das Hochwasser zu erwarten. Als Perimeterdämmung werden üblicherweise extrudiertes Polystyrol (XPS), Schaumglas (CG), Polyurethan (PU), und in den letzten Jahren auch expandiertes Polystyrol (EPS) eingesetzt.
Andere geschlossenzellige Dämmstoffe auf Kunststoffbasis (z.B. Phenolharz (PF), synthetischer Kautschuk oder Polyethylen (PE)) verhalten sich ähnlich. Sie werden im Zulassungsverfahren zwar in der Regel nicht auf Wasseraufnahme untersucht, nehmen aber schon aufgrund ihrer Porenstruktur mit geschlossenen Hohlräumen kaum Wasser auf.
Expandiertes Polystyrol (EPS) gilt zwar als offenzelliger Dämmstoff, nimmt aber bei Lagerung unter Wasser ebenfalls nur geringe Mengen Feuchtigkeit auf. Das gilt auch für EPS mit geringer Rohdichte, wie es häufig in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) zur Fassadendämmung eingesetzt wird. EPS wird auch häufig als Trittschalldämmung eingesetzt. Hier existieren langjährige Erfahrungen mit Wasserschäden aus Wasch- und Spülmaschinen. Mit der richtigen Trocknungstechnik werden Trittschalldämmung und Estrich wieder trocken. Für die Dämmung entsteht aus einem solchen Wasserschaden keine dauerhafte Schädigung.
Offenzellige anorganische Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle (MW), expandierte Perlite (EP) und andere Schüttdämmstoffe nehmen beim Untertauchen bis zu einem gewissen Grad (abhängig von der Hydrophobierung des Materials) Wasser auf. Sie können es aufgrund ihrer offenen Struktur aber auch relativ rasch wieder abgeben. Für viele Dämmstoffe bedeutet eine einmalige Durchnässung nicht automatisch, dass sie dauerhaft geschädigt werden. Mineralwolleplatten für den Einsatz in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) werden bei der Herstellung mit einem Spezialöl behandelt. Dabei werden die Fasern wasserabweisend eingestellt. Kommen während der Durchfeuchtung keine weiteren Belastungen aus mechanischer Beanspruchung und Verunreinigung der Dämmschicht und erhöhter Temperatur hinzu, haben die Mineralwolleplatten nach der Trocknung wieder ähnliche Eigenschaften wie vor dem Hochwasser.
Wichtig zu wissen: Kann viel Wasser in die Konstruktion eindringen, erhöht sich das Eigengewicht der Dämmung. Befestigungen (Dübel, Schienen, Schrauben, Nägel) sind einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt. Zudem kann die Haft- und Querzugfestigkeit direkt angebrachter Schichten (z.B. Putzschichten) beeinflusst sein. Werden hier Verformungen oder Risse festgestellt, sollte die Fassadendämmung komplett erneuert werden.
Bei losen Dämmungen, zum Beispiel im zweischaligen Mauerwerk und bei Holzständerbauweise, (Mineralwolleflocken, expandierte Perlite (EP), etc.) besteht nach dem Abfließen des Wassers die Gefahr von Setzungen und Bildung von Hohlräumen, die zu Wärmebrücken nach der Austrocknungszeit führen. Erkennen kann man solche Stellen durch thermografische Aufnahmen oder durch Untersuchungen mit einem Endoskop. Zu beachten ist hier, dass die Thermografie nur bei ausreichend großer Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen aussagekräftige Ergebnisse liefert - also vor allem während der Heizperiode im Winter. Perlite und Mineralwolle werden auch zur Verbesserung der Dämmeigenschaften in hochwärmedämmenden Mauersteinen eingesetzt. Üblicherweise haben diese Dämmstoffe für die Verwendung in den Kammern von Mauersteinen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (als Dämmstoff für das zweischalige Mauerwerk) und sind vollständig hydrophobiert. Sie nehmen daher nur langsam Wasser auf. Die Austrocknung dauert bei solchen gefüllten Mauersteinen jedoch länger als bei ungefüllten Steinen mit Luftkammern.
Leichte Faserdämmstoffe für den Einsatz in Steildächern oder Holzbauwänden reagieren meist empfindlich auf Durchfeuchtung. Zudem sind hier meistens auch Holzbauteile betroffen, die offengelegt werden müssen um schnell und gut austrocknen zu können. Viele organische Dämmstoffe wie zum Beispiel Holzfasern (WF), Zellulose, Hanf, Flachs etc. können große Mengen Wasser aufnehmen. Hier ist ein Ausbau der Dämmung ratsam, um eventuelle Fäulnis oder Schimmelpilzschäden zu vermeiden.
Wann droht Schimmel an der Dämmung?
Bei einer einmaligen und zeitlich begrenzten Durchnässung (zum Beispiel bei Hochwasser) ist dann nicht mit Schimmelpilzbildung zu rechnen, wenn es gelingt, durch rasche Trocknung die Feuchtigkeit unter 80 Prozent zu bringen.
Können Dämmung und Wandkonstruktion wieder austrocknen?
Monolithisches Mauerwerk mit üblichen Putzschichten trocknet langsamer aus als monolithisches Mauerwerk ohne Putz. Der Grund ist ein verringerter Kapillartransport über die Grenzschicht zwischen Mauerwerksbaustoff und Putz. Befindet sich an einer solchen Wand zusätzlich noch eine Dämmung, kann die Austrocknung nur noch durch Wasserdampfdiffusion stattfinden, die bei diffusionshemmenden Dämmstoffen entsprechend langsam verläuft. Die Austrocknungsgeschwindigkeit hängt hier direkt von den Wasserdampfdiffusionswiderständen des Putzes und der Dämmschicht ab.
Eine Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), bei der direkt Wasser in die Dämmung eingedrungen ist, trocknet im System mit EPS oder mit Mineralwolle innerhalb eines Jahres wieder aus. Das massive Mauerwerk dahinter ist nach circa zwei bis drei Jahren wieder bei dem Ausgleichsfeuchtegehalt angelangt, den es vor dem Hochwasser hatte. Wenn Räume während der Austrocknung voll genutzt werden, sollten Raumluftproben analysiert werden, um flüchtige Stoffe aus der Diffusion zur Raumseite zu identifizieren, welche die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen können.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Ratgeber Hochwasser
Produkte im Bereich Ratgeber Hochwasser
Sanierungsforum
-
Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?
Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...
Antwort lesen » -
Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?
In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...
Antwort lesen » -
Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?
Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...
Antwort lesen » -
Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?
Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?
Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...
Antwort lesen » -
Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?
Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...
Antwort lesen » -
Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?
Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?
In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?
Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?
In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...
Antwort lesen » -
Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?
Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen » -
Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?
Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...
Antwort lesen » -
Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?
Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...
Antwort lesen » -
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.
Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?
Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort