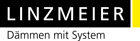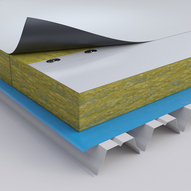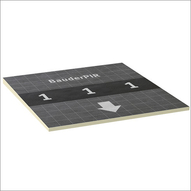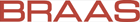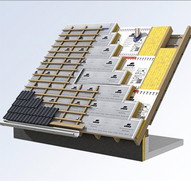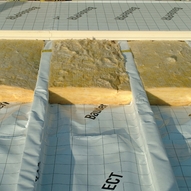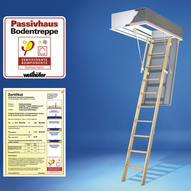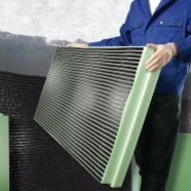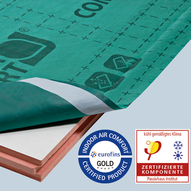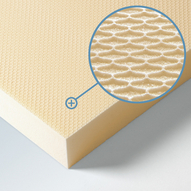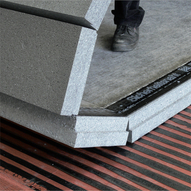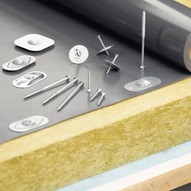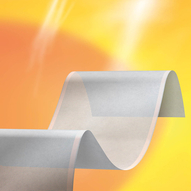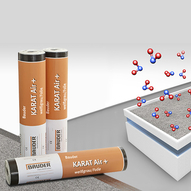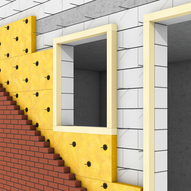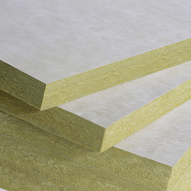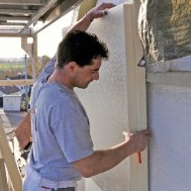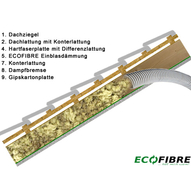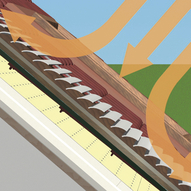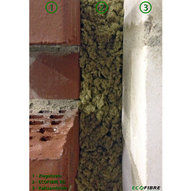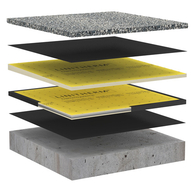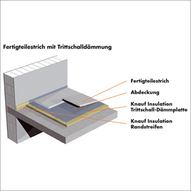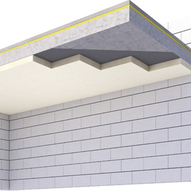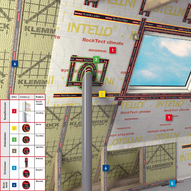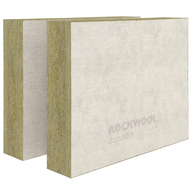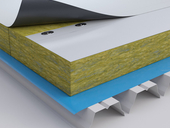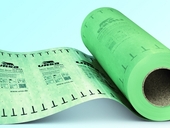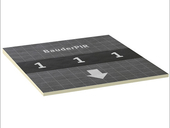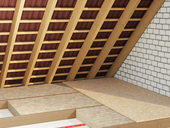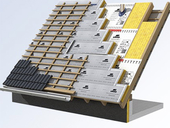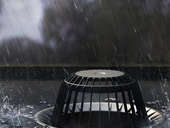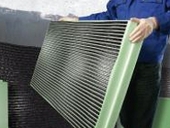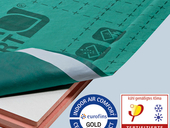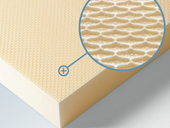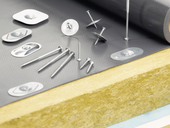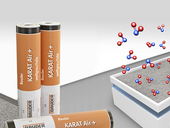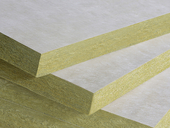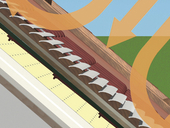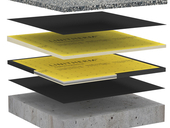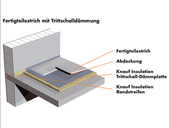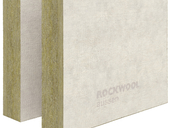x
x
- Dämmung
- Heizung & Lüftung
- Strom & Solar
- Dach
- Fassade
- Keller
- Innenausbau
- Bad
- Grundstück & Garage
- Service, Tools, News, Forum »Beratung & Förderung
- Versicherung
- Ratgeber
- Ratgeber Sanierungsplanung
- Ratgeber Frühjahrscheck
- Ratgeber Hitzeschutz
- Ratgeber Herbstcheck
- Ratgeber Winter
- Ratgeber Schimmel
- Ratgeber Schallschutz
- Ratgeber Schadstoffsanierung
- Ratgeber Einbruchschutz
- Ratgeber Barrierefreiheit
- Ratgeber Hochwasser
- Ratgeber Unwetterschutz
- Ratgeber Schöner Sanieren
- Ratgeber Denkmalschutz
- Ratgeber Thermografie & Blower Door
- Ratgeber Heizkosten sparen
- Ratgeber Energiesparen für Mieter
- Infos, News & Tools
Sanierungsstory Einblasdämmung: Klinkerhaus günstig saniert
Wärmeschutz von 50er-Jahre-Einfamilienhaus deutlich verbessert
Eine energetische Sanierung, die Dämmung eines Hauses - unbezahlbar heißt es oft. Dass es auch anders geht, zeigt unser Sanierungsbericht: Ein kleines Einfamilienhaus am Niederrhein aus den 50er Jahren, bewohnt von einer alleinerziehenden Mutter mit ihrem Sohn. Ihrem Beruf als Physiotherapeutin geht sie im Erdgeschoss des Hauses nach. Mit einer Einblasdämmung konnte der Wärmeschutz deutlich verbessert werden, mit kleinem Budget.





Das Gebäude, als regional-typisches Klinkerhaus in den 50er Jahren mit zweischaligem Mauerwerk gebaut, hat eine Grundfläche von 10 x 8 Metern. Es ist 1,5-geschossig gebaut, mit 4 Zimmern im ersten Stock (Dachschräge) und 2 Zimmern im EG, darunter der Praxisraum. Eine Wärmedämmung war bei keinem einzigen Bauteil vorhanden. Vor der Dämmung verbrauchte das Gebäude pro Jahr durchschnittlich 2.800 l Heizöl. Die Heizkosten beliefen sich 2007 auf 130 Euro monatlich. Bei einem Gesamtwirkungsgrad der (alten) Heizungsanlage von max. 75 Prozent emittierte das Haus vor der Sanierung rd. 10 to CO2 pro Jahr.
Um die Kosten gering zu halten, beteiligte sich die Familie an den Arbeiten (Einfüllen des Dämmstoffs in die Verblasmaschinen, Aufräumen usw.). Es gab ein maximal auszuschöpfendes Budget von 2.500 Euro (*Kosten und Budget beziehen sich auf das Sanierungsjahr 2008). Die Besonderheit dieses Gebäudes war, dass sowohl die Wand, als auch die Dachschräge, die Holzbalkendecke zum Spitzboden als auch der Fußboden zum Keller hohlschichtig ausgebildet waren – diese Hohlschichten waren leicht zugänglich und nicht gedämmt.
1. Fassadendämmung zweischaliges Mauerwerk: Einblasdämmung für die Außenwand
Den größten Teil der Gebäudehüllfläche bildet die Außenwand, die bei dem Gebäude zweischalig ausgeführt wurde. Zweischalige Außenwände mit Luftschicht sind in ganz Norddeutschland eine vorherrschende Bauform. Sie haben einen Anteil von rund 30 Prozent an den deutschen und 60 Prozent an den norddeutschen Gebäudefassaden.
Die 100 m² opake Wandfläche des Kinlkerhauses besitzt eine Hohlschicht von 6 Zentimetern. Diese wurde mit dem mineralischen Kerndämmstoff SLS20 WLS 035 gedämmt.
Und so lief die Dämmung der Fassade ab:
Die Ziegelwand wurde (in den T-Fugen) angebohrt, eine Düse aufgesetzt, durch welche anschließend der Dämmstoff in die Wand eingeblasen wurde. Bei rieselfähigen Produkten werden wenige Einblasöffnungen benötigt (in diesem Fall insgesamt ca. 25 Stück). Nach den Dämmarbeiten wurden die Einblasöffnungen mit Fugenmörtel "unsichtbar" verschlossen.
Während der Einblasdämmung stellte sich heraus, dass es Undichtigkeiten in der Wand gab: Diese äußerten sich durch den Austritt von Dämmstoff-Staub (zum Glück nur nach außen, auch Staub-Erscheinungen nach innen treten bei diesem Dämmverfahren oft auf und lassen sich durch geeignete Maßnahmen bzw. Verwendung von anderen Dämmstoffen - z.B. Glaswolleflocken - verhindern). Diese Undichtigkeiten zeigen aber auch, dass der Begriff "stehende Luftschicht" für zweischaliges Mauerwerk nicht zutrifft.
Der Anfangs-U-Wert der Wand lag bei 1,3 W/m²K, nach Einblasen eines 035er Dämmstoffes in einer Dicke von 6 Zentimetern sank der U-Wert auf 0,43 W/m²K - also eine Verdreifachung des Dämmwertes der Wand. Zum Vergleich: Ein außen aufgebrachtes WDVS wäre nicht nur um den Faktor 10 teurer, sondern würde das regionaltypische Aussehen des Hauses auch verändern und wäre zudem aufgrund von Hinterlüftungseffekten sogar weitgehend wirkungslos!
2. Dämmung von Dachschräge und Holzbalkendecke mit Einblasdämmung
Zeitgleich wurden die Dachschräge und die Holzbalkendecke (Kehlbalkenlage) gedämmt: In den Dachschrägen befand sich keinerlei Dämmstoff (bei Gebäuden bis in die 70er Jahre durchaus üblich), allerdings hatte das Dach bei einer Dachsanierung schon eine Unterdeckbahn erhalten. Das erleichterte die Dämmung der Dachschrägen (insgesamt ca. 40 m², Dicke 14 cm) mit Zellulose-Einblasdämmstoff WLS 039. Der U-Wert der Dachschrägen sank von 3,2 W/m²K auf ca. 0,25 W/m²K - der Wärmeschutz wurde damit um den Faktor 13 verbessert!
Im gleichen Zuge wurde auch die oberseitige Dämmung der (ein paar Jahre alten, nachträglich eingebauten) Dachgaube von 10 cm (Mineralwolle) auf insgesamt 20 cm (Mineralwolle incl. Zellulose) ergänzt. Diese Dämm-Maßnahme dauerte insgesamt 1 Minute!
Die Kehlbalkenlage (Holzbalkendecke) war, wie fast alle derartigen Bauteile in deutschen Gebäuden, hohlschichtig und nicht gedämmt. Die Fläche von ca. 60 m² wurde in einer Dicke von 14 cm mit Zellulose WLS 039 gedämmt. Da man den größten Teil der Geschossdecke nicht als Lagermöglichkeit benötigte, wurden die Einblasdämmarbeiten gleich auf die bisherige Arbeitsebene, die Kehlbalkenlage, ausgedehnt. Einen Laufsteg für den Schornsteinfeger hatte die Eigentümerin schon im Vorfeld erstellt.
Der U-Wert der Holzbalkendecke, in einer Dicke von 14 cm eingeblasen, sank von 3 W/m²K auf 0,25 W/m²K (Verzwölffachung der Dämmwirkung). Die Fläche, die zusätzlich eine Aufblasdämmung von 26 cm erhielt (mithin insgesamt 40 cm Dämmung), hatte nach der Dämmmaßnahme einen U-Wert von 0,1 W/m²K. Ebenso wie bei der Außenwand wäre eine nur oberseitige Dämmung der Holzdielen aufgrund von Hinterlüftungseffekten wirkungslos gewesen. Das Ausblasen der Hohlschicht in der Kehlbalkenlage ist eine notwendige Voraussetzung für eine energetisch wirkungsvolle Dämmung der Holzdielen oberseits.
3. Weiterer Sanierungsfall: Erdgeschoss-Fußboden zum Keller hin
Der Fußboden des Praxis-Raumes (ca. 50 m²) ist als Dielenholzfußboden ausgebildet. Konstruktiv bedingt sind die Nadelholzdielen auf eine Balkenlage genagelt, die Nagelreihen sind von oben sichtbar. Oft, und so auch in diesem Fall, befindet sich in den Gefachen unter den Dielen nichts außer Luft (manchmal auch Schlacke/Asche oder Lehm). Die Lagerhölzer haben eine Höhe von 8 cm. Möchte man diese Gefache mit Faserdämmstoffen wie Glaswolle oder Zellulose ausblasen, müssen am Rand einzelne Dielen entfernt werden, der Schlauch weit in die Gefache eingeführt und dann sukzessive gedämmt werden. Die Entfernung der Dielen war nicht gewünscht. Also wurden von oben Öffnungen mit einem Durchmesser von 2 cm in die Dielen gebohrt, eine Einblasdüse aufgesetzt und der Hohlraum von 8 cm mit Polystyrol-Kügelchen WLS 033 gefüllt. Nach dem Einblasen wurden die Öffnungen mit handelsüblichen Holzpfropfen verschlossen und von der Eigentümerin selber nachgearbeitet.
Der U-Wert des Fußbodens sank damit von 2 W/m²K auf 0,34 W/m²K - eine Versechsfachung des Wärmeschutzes. Dauer der Maßnahme: 1,5 Stunden.
Eine weitere Fußbodenfläche (30 m²) war nicht hohlschichtig, sondern massiv und mit Fliesen belegt, und konnte nur von unten unter der Kellerdecke gedämmt werden. Die Eigentümerin erhielt dafür 30 m² Phenolharzplatten WLS 021, 60 mm dick, um diese später in Eigenleistung von unten (Kellerdecke) anzubringen (kleben und dübeln).
Fazit und Ergebnis:
Die Dämm-Maßnahmen von Wand, Dach, OG-Decke und Fußboden benötigten nur einen Tag und zwei Fachleute unter Mithilfe der Hauseigentümer (2 Handlanger). Der Kostenrahmen von 2.500 Euro wurde eingehalten (*Kosten und Budget beziehen sich auf das Sanierungsjahr 2008). Eine finanzielle Förderung seitens der Bundesregierung gab es 2008 noch nicht. Der Heizenergiebedarf des Gebäudes sank um über 60 Prozent (von 2.800 l Heizöl auf weniger als 1.100 l), entsprechend sank der CO2-Ausstoß (Gebäudeheizung) von 10 to/a auf weniger als 4 to pro Jahr).
Die finanzielle Amortisationszeit der Maßnahmen beträgt damit 1,6 Jahre. Die CO2-Vermeidungskosten (auf 50 Jahre hin gerechnet) liegen bei 0,8 ct pro kg CO2. Seit Durchführung dieser Maßnahme sparte das Gebäude bis zum Jahr 2023 in 15 Jahren insgesamt 90 to CO2 ein.
Ein Gebäude dieser Art, bei dem alle relevanten Bauteile nicht nur nicht gedämmt sind, sondern sich als Hohlschichten auch für Einblasverfahren eignen, ist natürlich nicht der Normalfall und relativ selten. Die vorgestellten Verfahren jedoch können im Einzelnen bei über 2,5 Milliarden m² Gebäudehüllfläche eingesetzt werden und sind aufgrund der sehr niedrigen Kosten geeignet, auch einkommensschwächere Familien an der Energiewende und Klimaschutz zu beteiligen. Die Einblasdämmung erweist sich mit ihren Eigenschaften – funktionierend, einfach, schnell ausgeführt, bezahlbar und konsequent ökologisch – als ein bedeutender Hebel für den Klimaschutz, Bezahlbarkeit von Heizung und Schonung von endlichen, fossilen Energie-Ressourcen.
Auch wenn die Kosten für eine Einblasdämmung heute höher sind, bleibt die Maßnahme niedriginvestiv und kann inzwischen auch staatlich gefördert werden. Damit amortisiert sich die Einblasdämmung ähnlich schnell wie in diesem Sanierungsbericht.
Was kostet eine Dämmung? Hier können Sie kostenfrei und unverbindlich Vergleichsangebote einholen.
Aktuelles
-
26.04.2024
Update EEG / Solarpaket: Weitere Verbesserungen für Photovoltaik
Die Bundesregierung plant weitere Verbesserungen für Photovotaik-Anlagen und sogenannte Balkonkraftwerke. Ein Überblick zu Photovoltaik-Strategie und Solarpaketen.
-
25.04.2024
Was tun mit alter Fassadendämmung? WDVS aufdoppeln statt abreißen
Durchschnittlich 35 Jahre beträgt die Haltbarkeit eines Wärmedämm-Verbundsystems. Alte WDVS können durch eine Aufdoppelung saniert werden.
-
24.04.2024
Gesetzliche Anforderungen des GEG 2024 bei der Fassadendämmung
Stimmt der Wärmeschutz der Außenwände? Für die Fassadendämmung sind im GEG 2024 verbindliche Grenzwerte festgeschrieben. Sie greifen bei einer Dämmung und neuem Putz.
-
23.04.2024
Rückstausicherung verhindert Wasserschaden im Keller
Ein Wasserschaden im Keller ist bei Starkregen überall möglich. Damit es gar nicht erst zur Überschwemmung kommt, haben sich so genannte Rückstausicherungen bewährt.
-
23.04.2024
Förderung für neue Rollläden - Nachrüstung oder Erneuerung
Für Nachrüstung und Erneuerung von Rollläden gibt es mehrere Möglichkeiten der Förderung. Alle Infos und Details zu Zuschüssen vom BAFA, KfW-Kredit und Steuerbonus.
Dämmung
Informieren Sie sich und erfahren Sie mehr zum Thema Dämmung »
Prospekte
Bestellen Sie jetzt Prospekte rund ums Thema Dämmung. Wir liefern sie kostenfrei zu Ihnen nach Hause.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Dämmung
-
für Profis
Schlanke Fassadenbekleidung inklusive Fassadendämmung
Verbundelemente mit variablem Design für Fassade und Brüstung
-
für Profis
Flachdachdämmung abgestimmt auf die Flachdachabdichtung
Einheitlicher Flachdachaufbau für ein durchgängiges Dachsystem
-
für Profis
Wärmedämm-Verbundsystem mit Glas-Verkleidung
Fassadenplatten und Dämmung für die kreative Fassadengestaltung
-
für Profis
Feuchtevariable Dampfbremse für Holzkonstruktionen zugelassen
Sicherheit für Dachdämmung bei Holzfeuchte oder Undichtigkeit
-
für Profis mit Video
Mineralisches Wärmedämm-Verbundsystem für Sanierung und Neubau
Innovative, ökologische und brandsichere Dämmung der Fassade
-
Hightech-Dämmung im Denkmal-Dach
Dämmung zwischen den Sparren für effektiven Wärmeschutz
-
mit Video
Kerndämmung der Fassade mit Steinwolleflocken
Flexibel und kostengünstig: Fassadendämmung im Einblasverfahren
-
Nichtbrennbare Trittschalldämmung für die Fußbodenheizung
Bodendämmplatte aus Steinwolle mit Befestigung für Heizungsrohre
-
für Profis
Steinwolle-Dämmplatte mit geprüfter Hagelwiderstandsklasse HW5
Flachdachdämmung mit hagelsicherem Konstruktionsaufbau
-
für Profis
Effiziente Kerndämmung aus Mineralwolle für die Fassade
Dämmrolle punktet bei Fassadendämmung gegenüber Dämmplatten
-
mit Video
Schalldämmung: Trennwände in Trockenbauweise richtig dämmen
Dämmplatte aus Mineralwolle für Raumteiler verbessern Akustik
-
für Profis
Nachhaltig sanieren mit Aufsparrendämmung aus Biomasse
Biobasierter, ökologischer Dämmstoff mit hoher Dämmeffizienz
-
für Profis
Dachabdichtung schützt Dachdämmung vor Wind und Wetter
Abgestimmte Komplettsysteme garantieren Luftdichtheit
-
Flexibler Holzfaserdämmstoff für Zwischensparrendämmung im Dach
Holzfaserdämmplatten mit sehr guter Klemmwirkung im Zwischenraum
-
mit Video
Spezial-Sanierungsbahn für die einlagige Dachabdichtung
Dachsanierung mit leichter Oberlagsbahn ab zwei Prozent Neigung
-
Rundum gut gedämmt mit zweilagiger Fassadendämmung
Sanierung eines Altbaus zum Neubaustandard mit WDVS
-
mit Video
Einblasdämmung aus Steinwolle oder Zellulose fürs Steildach
Nachträgliche Dachdämmung schnell und wirtschaftlich ausführen
-
für Profis
Extra schlankes WDVS spart Platz bei der Fassadendämmung
Oberflächenfinish mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
-
Neuer Wohnraum im Haus durch Dachausbau dank Gaubenbausystem
Sanierung mit schnellem Einbau von Gauben im Dach plus Dämmung
-
Dämmung der Kellerdecke schnell und einfach
Geringerer Energieverlust im Haus dank Dämmplatten im Keller
-
mit Video
Dünne Innendämmung mit Mineraldämmplatte
Mineralische Dämmung beugt Schimmel im Innenraum vor
-
Wärmedämm-Verbundsystem aus Steinwolle-Putzträgerplatten
WDVS ohne Kompromisse bei Wärme-, Schall- und Brandschutz
-
Feuchtevariable Dampfbremse schützt Dachdämmung vor Feuchtigkeit
Vlieskaschierte Polyamidfolie beugt Feuchtigkeitsschäden vor
-
für Profis mit Video
Aufsparrendämmung senkt Heizkosten und optimiert Schallschutz
Gute Dämmung und neue Dacheindeckung zahlen sich aus
-
für Profis
Zweilagige Fassadendämmung bietet besten Wärmeschutz
Steinwolleplatten bis 400 Millimeter Dämmdicke im WDVS möglich
-
für Profis mit Video
Beanspruchtes Flachdach mit leichter Bitumenbahn sanieren
Flachdachabdichtung mit Sanierungsbahn schnell instand setzen
-
mit Video
Brandschutz erhöhen via Einblasdämmung
Installationsschachtdämmung aus nicht brennbaren Steinwollflocken
-
für Profis mit Video
Alukaschierte PIR-Gefälledämmung für Flachdächer
Zuverlässige Entwässerung und schnelle Verlegung der Dachdämmung
-
für Profis mit Video
Nichtbrennbare Steinwolledämmplatte für die Flachdachdämmung
Wirtschaftlich und sicher: Dämmplatte für verklebte Dachaufbauten
-
mit Video
Innendämmung mit Mineraldämmplatte schafft gesundes Wohnklima
Schimmel vorbeugen und Heizkosten sparen mit ökologischer Dämmung
-
Den Dachboden nach GEG dämmen
Hocheffiziente Dämmung der obersten Geschossdecke mit Dämmfilz
-
für Profis mit Video
Schlanke und effiziente Dämmung unter den Sparren
Dachdämmung mit Dachausbau schafft neuen Wohnraum
-
für Profis
Außen geht nichts? Kellerwand von innen dämmen
Innendämmung für gesundes Wohnklima im Keller
-
-
mit Video
Lückenlos und effizient dämmen mit extra dünner Aufsparrendämmung
Hochwertige Dachdämmung schont Klima, spart Heizkosten im Altbau
-
für Profis mit Video
Flachdach abdichten mit besonders leichter Bitumenbahn
Blähglasgranulat sorgt für geringeres Gewicht der Dampfsperrbahn
-
für Profis
Hoch wärmedämmende Dämmplatte fürs Schrägdach
Erhöhter Wärmeschutz bei geringer Dämmdicke der Aufsparrendämmung
-
für Profis mit Video
Holzfaserdämmplatte mit Klimakammern für die Innendämmung
Bester Schallschutz mit nur 30 Millimetern Dämmung
-
für Profis
Flächige Verlegung der Dampfbremse schützt Dachdämmung optimal
Feuchtetransport und Luftdichtheit bei Steildachsanierung Pflicht
-
für Profis mit Video
Optimale Gefälledämmung fürs Flachdach
Angeschrägte PU-Dämmplatte erlaubt Gefälle bis zu 9,6 Meter
-
mit Video
Dachausbau: Wohngesund dämmen mit Mineralwolle-Dämmung
Ökologische und sichere Dachdämmung fürs ausgebaute Dachgeschoss
-
mit Video
Nachhaltige Dachsanierung mit neuer ECO-Aufsparrendämmung
Alte PU-Hartschaumdämmung als Basis für neue ökologische Dämmung
-
mit Video
Aufsparrendämmung überzeugt bei ausgebautem Dachgeschoss
Nachträgliche Dachdämmung mit Hochleistungs-Dämmelementen
-
für Profis
Belastbare Gefälledämmung für Flachdächer mit Photovoltaik-Anlage
Flachdachdämmplatte mit erhöhter Druckspannung
-
mit Video
Langlebige und nachhaltige Aufsparrendämmung
Sturm- und Hagelschäden mit Dachdämmung minimieren
-
mit Video
Multifunktionale Zwischensparrendämmung mit Dreifach-Schutz
Wenig Wärmeverlust, mehr Schall- und Brandschutz fürs Schrägdach
-
mit Video
Ökologischer Dämmstoff auf Biomassebasis für die Dachdämmung
Besonders dämmstark: Ökologische Aufsparrendämmung auf PU-Niveau
-
mit Video
Fassadendämmung: Holzfaserdämmplatten für WDVS
Atmungsaktive Holzfaserdämmung für Fassaden mit Kosten-Spar-Effek
-
mit Video
Dämmung mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade zahlt sich aus
Wasserabweisende Fassadendämmplatte für beste Energiebilanz
-
Abdichtung plus Trittschalldämmung für Boden mit Fliesenbelag
Feuchtigkeitsschutz und Überbrückung von Rissen in einem Schritt
-
für Profis
Nachträgliche Kerndämmung für dünnes zweischaliges Mauerwerk
Einblasdämmung: Lückenfreie Fassadendämmung mit EPS-Dämmperlen
-
für Profis
Be- und Entlüftung sowie Entwässerung auf dem Flachdach
Entwässerungs- und Lüftungselemente ergänzend zur Dachabdichtung
-
für Profis mit Video
Punktgenaue Dachentwässerung dank Dachreiter für Gefälledämmung
Damit Flachdächer langfristig trocken bleiben
-
für Profis mit Video
Mit neuer Aufsparrendämmung vom Altbau zum Passivhaus
Komplettes Sanierungssystem für zukunftssichere Dachdämmung
-
für Profis mit Video
Alte Fassadendämmung energetisch sanieren mit Sanierungskit
Aus altem WDVS wird vorgehängte hinterlüftete Fassade
-
-
für Profis mit Video
Effiziente Linienentwässerung als Set-Lösung für das Flachdach
Mit Gefälledämmung Regenwasser gezielt ableiten
-
mit Video
Sanierungsbericht Holzfaserdämmung: 500 Jahre altes Fachwerkhaus
Von Grund auf saniert und innen mit Holzfasern gedämmt
-
für Profis
Schrägdach: Befestigungsempfehlung für die Aufsparrendämmung
Schrauben für Aufsparrendämmplatten zuverlässig berechnen
-
für Profis mit Video
Kapillaraktive Innendämmung der Fassade
Wohngesunde Fassadendämmung aus Ziegeln mit Perlit-Füllung
-
für Profis
Flexibles Dämmrahmen-Set für Dachfenster
Dachflächenfenster sicher und wärmebrückenfrei dämmen
-
-
Energieeffiziente Dachdämmung mit Aufsparrendämmplatte
Aufsparrendämmung: Perfekte Ergänzung zur Zwischensparrendämmung
-
mit Video
Sanierungsbericht: Ökologische Dachdämmung 50er-Jahre-Haus
Steildachsanierung mit nachhaltigem Dämmstoff auf Biomassebasis
-
für Profis
Gesunde Raumluft: Schadstoffarme PU-Dämmstoffe für Dachdämmung
Emissionsarme Dämmung im Verzeichnis "Gesündere Gebäude" gelistet
-
für Profis mit Video
Neues Luftdichtsystem: Feuchteschutz und Brandschutz in einem
Sicheres Dach mit schwerentflammbarer Dampfbremse für Dachdämmung
-
Wärmebrückenfreie Dachbodendämmung mit Steinwolleflocken
Schütt- und Aufblasdämmung sorgen für einheitliche Dämmschicht
-
für Profis
Bauwerksabdichtung: Perimeterdämmung bei drückendem Grundwasser
Wasserabweisender Bitumen-Kleber schützt Keller-Dämmplatten
-
für Profis
Sichere Montage von Dachsystemteilen auf der Steildachdämmung
Schneefang und Co: Universelle Befestigung für Aufsparrendämmung
-
-
Schlanke Kellerdeckendämmung für gemütliche Wohnräume
Die richtige Dämmplatte für jede Kellerdecke
-
für Profis
Flachdachdämmung mit Multilayer-Technologie für Umkehrdächer
Extruderschaumplatten mit Stufenfalz verhindern Wärmebrücken
-
mit Video
Sanierungsbericht: Nachträgliche Kerndämmung Einfamilienhaus
Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk Schritt für Schritt
-
-
für Profis mit Video
Gute Kombi bei zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung und WDVS
Einblasdämmung mit Steinwolleflocken verbessert Dämmwert des WDVS
-
mit Video
Sanierungsbericht: Dämmen in Eigenleistung mit Holzfaserdämmung
Alte Käserei mit natürlicher Innendämmung zum Wohnhaus saniert
-
mit Video
Bodentreppe mit Wärmeschutz macht Dämmung von Dachboden perfekt
Dichter Einbau mit Deckenanschluss-System und spezieller Dichtung
-
Gut eingepackt: Effiziente Kerndämmung für die Fassade
Kerndämmplatte punktet mit schlankem Aufbau bei besten Dämmwerten
-
Wohnungs- oder Gebäudetrennwand nachträglich dämmen
Schallschutz verbessern mit nachhaltiger Einblasdämmung
-
mit Video
Bewährtes Duo im Altbau: Innendämmung und Wandheizung
Abgestimmtes System - Mineraldämmplatte, Wandheizung und Lehmputz
-
für Profis
Dachfenster nachrüsten mit Dämmzarge und Aufkeilrahmen
Dachfenster schnell und sicher in die Dachdämmung integrieren
-
mit Video
Zero Waste: Rückbaubares WDVS aus Mineralwolle oder Holzfaser
Recyclingfähige Fassadendämmung komplett sortenrein trennbar
-
Robuste Dämmplatten und Dämmlamellen für die Kellerdeckendämmung
Verschiedene Dämmplatten erfüllen alle Oberflächen-Ansprüche
-
Wohngesunde Einblasdämmung für die nachträgliche Fassadendämmung
Zweischaliges Mauerwerk zeit- und kostensparend dämmen
-
mit Video
Sanierungsbericht: Feuchtes Mauerwerk wohngesund saniert
Altbausanierung ohne Trockenlegung dank Entsalzungssystem
-
für Profis mit Video
Dünne Aufsparrendämmung mit Passivhaus-Zertifikat
Hochleistungsdämmstoff für Dachsanierung im Passivhaus-Standard
-
für Profis
Bester Halt für Perimeterdämmung durch Waffelstruktur
Optimal dämmen im Sockel- und Wärmebrückenbereich
-
für Profis
Dachsanierung: Kombidämmung verbessert Dämmleistung im Altbau
Aufsparrendämmung ergänzt Zwischensparrendämmung
-
Holzbauweise: Ökologische Fassadendämmung aus Holzfasern
Diffusionsoffene Holzfaserplatte für optimalen Feuchtetransport
-
für Profis
Doppelte Dachdämmung für besten Wärmeschutz
Wohlfühlklima dank Kombi aus Auf- und Zwischensparrendämmung
-
für Profis
Sicherheitsdämmbahnen mit 2-in-1-System für das Flachdach
Drei Quadratmeter Dämmung und Abdichtung in einem Arbeitsgang
-
für Profis mit Video
Zeit sparen bei der Fassadendämmung
Steinwolle-Putzträgerplatte für effiziente WDVS-Verarbeitung
-
für Profis mit Video
Mit vorgefertigten WDVS-Fensterzargen effizienter sanieren
Konfigurierbares Fensterelement vereinfacht Fassaden-Anschluss
-
mit Video
Hagelsichere, robuste Dämmplatten für die Aufsparrendämmung
Dachdämmung schützt Haus zuverlässig vor Hagelschaden
-
für Profis mit Video
Dachsanierung mit Aufsparrendämmung nach dem Dachausbau
Einbaufertige Dachdämmung für das bewohnte Dachgeschoss
-
Flachdachbefestiger für das sturmsichere Dach
Mechanische Windsogsicherung von Dachabdichtung und Dämmung
-
für Profis
Schlank oder extra ruhig: Trittschalldämmung für jeden Bedarf
Trittschallschutz mit schlankem Systemaufbau ideal für Sanierung
-
für Profis
Aufsparrendämmung für Metalldächer
Steildach mit Dacheindeckung aus Metall wirtschaftlich dämmen
-
Doppelte Dachdämmung mit Steinwolle sorgt für mehr Wohnkomfort
Vom Altbau zum zeitgemäß gedämmten Wohlfühl-Haus
-
Extrastarke Dachbodendämmung aus Steinwolle
Für genutzten Dachboden Dämmung begehbar ausführen
-
für Profis mit Video
Aufsparrendämmung für gewölbte Dächer, Tonnendach und Gaube
Flexible PU-Dämmplatten vom kleinen bis zum großen Radius
-
für Profis mit Video
Schüttbarer Niveauausgleich aus Blähglasgranulat fürs Flachdach
Schnell begehbare Ausgleichsschüttung mit hoher Druckfestigkeit
-
für Profis
Biobasierte Dämmung für schlanke Dachaufbauten
Ökologische Aufsparrendämmung mit aufkaschierter Unterdeckbahn
-
Effiziente Dachbodendämmung für jeden Bedarf
Dämmvarianten für begehbare und nicht begehbare Dachböden
-
Einfache Dachdämmung dank Einblasdämmung
Dächer in Holzbauweise schnell und wirkungsvoll dämmen
-
für Profis
Dichtklebstoff zum Verkleben von Dampfbremsen im Steildach
Luftdichter Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile
-
mit Video
Flachdach-Dämmplatte aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen
Nachhaltige Flachdachdämmung mit ökologischem Dämmstoff
-
für Profis
Kerndämmung: Steinwolle-Dämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit 033
Formstabile Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk
-
mit Video
Atmungsaktive Dämmplatten aus Holzfaser für die Fassadensanierung
WDVS der Oberklasse: Weniger Heizverluste und gesundes Raumklima
-
mit Video
Abgestimmte Systeme für die Innendämmung
Fassade im Altbau: Die alternative Art der Dämmung
-
mit Video
Die Ökologische: Dachdämmung mit Holzfaser
Bester sommerlicher Wärmeschutz mit Holzfaserdämmung
-
mit Video
Flächentemperierte Carbonbahn nutzt Strahlungswärme
Komfortabel heizen mit Flächenheizung an Wand, Decke und Boden
-
für Profis
Absturzsicherung für das Flachdach
Seilsysteme und Geländersysteme sichern Profis bei Dacharbeiten
-
Nachträgliche Hohlraumdämmung im Flachdach
Einblasdämmung aus Steinwolle für schwer zugängliche Dachbereiche
-
mit Video
Energiesparen in Eigenleistung: Dämmung der Rohrleitungen
Warmwasser- und Heizungsrohre dämmen und Wärmeverlust minimieren
-
für Profis mit Video
Innensanierungssystem befreit den Keller von Schimmel
Schnelle Maßnahmen gegen Schimmel und feuchte Kellerwände
-
mit Video
Luftreinigende Abdichtungsbahn reduziert Luftverschmutzung
Bitumendachbahn sorgt für saubere Luft auf dem Flachdach
-
für Profis
Flachdachdämmung mit ökologischen und robusten Mineraldämmplatten
Mineralische Flachdachdämmung bietet viele Vorteile bei Sanierung
-
mit Video
Dach am besten mit Aufsparrendämmung dämmen
Dünne Hochleistungsdämmplatten sind schnell verlegt
-
mit Video
Schlanke und hagelfeste Dachdämmung mit Polyurethan-Hartschaum
Steildächer energetisch aufwerten mit einer Aufsparrendämmung
-
mit Video
Sanierungsbericht Doppelhaus: Ökologisches WDVS aus Holzfaser
Heizkosteneinsparung dank nachträglicher Fassadendämmung
-
für Profis
Wohngesundheit: Das gesündere Schrägdach inklusive Dämmung
Vier zertifizierte Dachaufbauten garantieren gesunde Raumluft
-
für Profis
Mauerrandstreifen ergänzt Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk
Extruderschaumstreifen verhindern Wärmebrücken an Tür und Fenster
-
für Profis mit Video
Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte für das genutzte Flachdach
Flachdach mit Photovoltaik oder Dachterrasse ideal dämmen
-
mit Video
Zweischichtige Dämmplatte für eine sicher gedämmte Kellerdecke
Schichtaufbau schützt Dämmstoff vor Beschädigung bei der Montage
-
mit Video
Mit Hohlraumdämmung von Fassade und Co Schallschutz verbessern
Dämmung aus Steinwolleflocken sorgt für mehr Ruhe im Haus
-
für Profis
System für die Gaubensanierung ermöglicht homogene Abdichtung
Dachdämmung und Gaubendämmung aus einem Guss
-
für Profis mit Video
Ideal bei Altbausanierung: Schlankes System für die Innendämmung
Dünne Holzfaserdämmplatte sorgt für warme Innenwände ohne Dübeln
-
für Profis mit Video
Flachdach-Ausstieg für Bodentreppen
Zugang zum Flachdach mit luftdichtem Anschluss und Wärmedämmung
-
für Profis
Dachdämmung bei Denkmalschutz
Dünne Dämmplatten punkten bei Dachsanierung von altem Speicher
-
für Profis mit Video
Effiziente Wärmedämmung dank vorgehängter hinterlüfteter Fassade
Dünne Dämmplatte erzielt beste Dämmwerte bei geringer Dämmdicke
-
Nachhaltige Kellerdeckendämmung mit mineralischem Oberflächenputz
Kellerdecken gesünder, ökologisch dämmen
-
mit Video
Sommerlicher Hitzeschutz fürs Dach aus Steinwolleflocken
Einblasdämmung punktet als flexible und effiziente Dachdämmung
-
Marderschutzdach: Dachdämmung vor ungebetenen Tieren schützen
So zerstören Marder und Co nicht die Dachdämmung
-
für Profis
Schlanke Aufsparrendämmung mit integrierter Dampfsperre
Geringe Dämmstärke bei hoher Dämmwirkung für schlanken Dachaufbau
-
für Profis
Der Wärmeschutz für den Sockel: Vollmineralische Sockeldämmung
Sockeldämmplatten für die Fassadendämmung mit WDVS
-
Mit Untersparrendämmung auch den Brandschutz verbessern
Dachdämmung mit Dämmstoffen aus Mineralwolle gibt Sicherheit
-
mit Video
Dünne Innendämmung für wenig Wohnraumverlust
Fassade effektiv dämmen auch bei Denkmalschutz
-
Natürliche Zwischensparrendämmung aus Glaswolle
Nachhaltige und umweltfreundliche Dachdämmung
-
Steinwolle-Kellerdeckendämmung farblich gestalten
Ansprechende Optik plus Wärmeschutz dank streichbarer Dämmplatte
-
Extraschlanke Trittschalldämmung zur Nachrüstung im Altbau
Dünnestrich erlaubt Sanierung des Fußbodens in Rekordzeit
-
Bodendämmung aus natürlichen Holzfasern
Komfortabler Trittschallschutz für Dielen, Parkett und Laminat
-
für Profis mit Video
Klinker: Schlanke Fassadenziegel für zweischaliges Mauerwerk
Reduzierte Außenschale bietet mehr Platz für Fassadendämmung
-
für Profis mit Video
Sichere und schnelle Aufsparrendämmung im Großformat
Mit XXL-Dämmplatten Dach in 90 Minuten vollständig gedämmt
-
mit Video
Wohngesunde, ökologische Innendämmung der Fassade
Fassadendämmung mit schadstofffreien Mineraldämmplatten
-
für Profis
Dämmstoff-Halter fixiert Steinwolle-Fassadendämmplatten
Vorgehängte hinterlüftete Fassade sicher befestigen
-
für Profis mit Video
Bodentreppe einbauen Schritt für Schritt
Fachgerechter, luftdichter Einbau spart deutlich Heizkosten
-
für Profis mit Video
Kombinierte Dämmung der Kellerdecke mit zwei Platten
Dämmplatten und Brandschutzplatten für Stahlbetondecken
-
für Profis mit Video
Perimeterdämmung: Vom Sockel bis zum Dach brandsicher gedämmt
Sockeldämmplatte aus Schaumglas ergänzt vollmineralisches WDVS
-
für Profis
Putzträgerplatte aus Steinwolle mit Bossennut für WDVS
Ästhetische Fassaden dank Deko-Dämmstoffplatte
-
mit Video
Kerndämmung schützt Fassade vor Feuchtigkeit
Feuchte Wände? Einblasdämmung aus Steinwolle beugt vor!
-
mit Video
Flexible Befestigung für Photovoltaik-Anlagen auf dem Flachdach
Dank Luftspalt rund 25 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung
-
für Profis
Flachdachdämmung: Verbesserter Wärmeschutz, maximaler Brandschutz
Dünne Steinwolle-Dämmplatte für höchste Anforderungen
-
für Profis
Dämmung mit Vakuumkern für Flachdach, Balkon und Terrasse
Dämmplatte mit extra dünner Aufbauhöhe bei höchster Dämmleistung
-
mit Video
Ökologische Dämmung der Kellerdecke verhindert aufsteigende Kälte
Kellerdämmung mit Mineraldämmplatten senkt Heizkosten
-
für Profis
Universalabdichtung vereinfacht Fenster-Anschlüsse an Dämmebene
Sicherer WDVS-Anschluss und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
-
Optimale Fußbodendämmung sorgt für Ruhe im Haus
Druckfeste Trittschalldämmung für Fertigteilestrich
-
mit Video
Untersparrendämmung ganz ohne Zuschneiden
Passgenaue Steinwolle-Dämmplatte erleichtert Dachdämmung
-
mit Video
Kerndämmung: Steinwolle-Flocken sorgen für Optimum an Dämmwirkung
Nachträgliche Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk
-
Nachträgliche Kellerdeckendämmung mit Extruder-Schaumplatten
XPS-Platten dämmen aufsteigende Kälte aus unbeheiztem Keller ein
-
mit Video
Historisches Fachwerkhaus clever saniert mit Steinwolledämmung
Einblasdämmung aus Steinwolle bewahrt denkmalgeschützte Fassade
-
für Profis mit Video
KSK-Abdichtungsbahn für dauerhaft trockene Wohnkeller
Kellerwände sicher mit "Allwetter"-Lösung abdichten
-
für Profis mit Video
Energetisch sanieren und gesund wohnen mit Lehm für die Innenwand
Lehmmörtel und Lehmfarbe für die Dämmung der Fassade von innen
-
für Profis mit Video
Luftdichtheitssystem für luftdichte Dachdämmung
Abgestimmte Komplett-Lösung hält Dach frei von Feuchtigkeit
-
mit Video
Streichbare Dämmplatte aus Steinwolle für die Kellerdecke
Kellerdeckendämmung, die sich verputzen und streichen lässt
-
für Profis
Natürliche Zwischensparrendämmung für gesundes Wohnklima
Dachdämmung mit modernem Hochleistungsdämmstoff
-
mit Video
Die Sensible: Innendämmung der Fassade
Flanken- und Laibungsplatten verhindern Wärmebrücken und Schimmel
-
mit Video
Innovative Einblasdämmung für die Fassade
Kerndämmung verbessert Wärme-, Schall- und Brandschutz
-
für Profis mit Video
Dünne Aufsparrendämmung mit besten Dämmwerten
Maximale Dämmleistung bei minimaler Materialstärke
-
für Profis
WDVS-Systemzubehör für gedämmte Fassaden
Nist-, Raffstorekästen und Co bündig in Fassadendämmung einbinden
-
Nachträgliche Dachdämmung gegen Fluglärm
Schallschutzdach: Dachsanierung bringt Ruhe ins Haus
-
mit Video
Moderne Innendämmung mit Mineraldämmplatten für historische Hülle
Fassadensanierung: Aus marodem Haus wird schmucke Villa
-
Schnell, flexibel und wohngesund: Einblasdämmung aus Mineralwolle
Vielseitige Dämmung für Fassade, Dach und Dachboden
-
mit Video
Schallschutz: Raumakustik verbessern mit Akustik-Dämmplatten
Nachträgliche Schalldämmung für die Decke aus Recyclingglas
-
für Profis
Unterspannbahn und Unterdeckbahn mit wasserabweisendem Vlies
Regensicheres Unterdach schützt Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit
-
für Profis
Fassadensanierung für alte Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
Wirtschaftliches Sanierungsverfahren für WDVS mit Kunstharzputz
-
für Profis mit Video
Hochdämmende Planziegel mit Mineralwolledämmung für Ziegelwände
Fassade von Mehrfamilienhäusern wärme- und schallschutzoptimieren
-
mit Video
Garantiert schimmelfrei mit Holzfaserdämmplatte
Kapillar aktive Innendämmung für die Fassade ohne Dampfsperre
-
mit Video
Erstes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit dem Blauen Engel
Umweltsiegel für natürliche Fassadendämmung
-
für Profis mit Video
Beschichtete Dämmplatte aus Steinwolle als Kernstück für WDVS
Fassadendämmung mit hoher Abreißfestigkeit und Dübeltragfähigkeit
-
mit Video
Heizkomfort trifft Design: Modernes Truhen- und Wand-Klimagerät
Heizen, Kühlen und Luftreinigung mit nachhaltiger Klimaanlage
-
Steinwolle-Lamellen für gewölbte Kellerdecken
Flexible Kellerdeckendämmung ideal bei Kellergewölbe im Altbau
-
für Profis mit Video
Bodendämmung: Trittschalldämmung aus nichtbrennbarer Steinwolle
Maximale Stabilität bei minimaler dynamischer Steifigkeit
-
für Profis
Einblasdämmung: Steinwolle-Granulat für den Holzbau
Holzhaus hohlraumfrei dämmen an nur einem Tag
-
Sanierung eines Baudenkmals mit Aufsparrendämmung
Sicherer Brandschutz dank Steinwolle-Dachdämmung
Produkte im Bereich Dämmung
-
für Profis
Schlanke Fassadenbekleidung inklusive Fassadendämmung
Verbundelemente mit variablem Design für Fassade und Brüstung
-
für Profis
Flachdachdämmung abgestimmt auf die Flachdachabdichtung
Einheitlicher Flachdachaufbau für ein durchgängiges Dachsystem
-
für Profis
Wärmedämm-Verbundsystem mit Glas-Verkleidung
Fassadenplatten und Dämmung für die kreative Fassadengestaltung
-
für Profis
Feuchtevariable Dampfbremse für Holzkonstruktionen zugelassen
Sicherheit für Dachdämmung bei Holzfeuchte oder Undichtigkeit
-
für Profis mit Video
Mineralisches Wärmedämm-Verbundsystem für Sanierung und Neubau
Innovative, ökologische und brandsichere Dämmung der Fassade
-
-
mit Video
Kerndämmung der Fassade mit Steinwolleflocken
Flexibel und kostengünstig: Fassadendämmung im Einblasverfahren
-
Nichtbrennbare Trittschalldämmung für die Fußbodenheizung
Bodendämmplatte aus Steinwolle mit Befestigung für Heizungsrohre
-
für Profis
Steinwolle-Dämmplatte mit geprüfter Hagelwiderstandsklasse HW5
Flachdachdämmung mit hagelsicherem Konstruktionsaufbau
-
für Profis
Effiziente Kerndämmung aus Mineralwolle für die Fassade
Dämmrolle punktet bei Fassadendämmung gegenüber Dämmplatten
-
mit Video
Schalldämmung: Trennwände in Trockenbauweise richtig dämmen
Dämmplatte aus Mineralwolle für Raumteiler verbessern Akustik
-
für Profis
Nachhaltig sanieren mit Aufsparrendämmung aus Biomasse
Biobasierter, ökologischer Dämmstoff mit hoher Dämmeffizienz
-
für Profis
Dachabdichtung schützt Dachdämmung vor Wind und Wetter
Abgestimmte Komplettsysteme garantieren Luftdichtheit
-
Flexibler Holzfaserdämmstoff für Zwischensparrendämmung im Dach
Holzfaserdämmplatten mit sehr guter Klemmwirkung im Zwischenraum
-
mit Video
Spezial-Sanierungsbahn für die einlagige Dachabdichtung
Dachsanierung mit leichter Oberlagsbahn ab zwei Prozent Neigung
-
Rundum gut gedämmt mit zweilagiger Fassadendämmung
Sanierung eines Altbaus zum Neubaustandard mit WDVS
-
mit Video
Einblasdämmung aus Steinwolle oder Zellulose fürs Steildach
Nachträgliche Dachdämmung schnell und wirtschaftlich ausführen
-
für Profis
Extra schlankes WDVS spart Platz bei der Fassadendämmung
Oberflächenfinish mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
-
Neuer Wohnraum im Haus durch Dachausbau dank Gaubenbausystem
Sanierung mit schnellem Einbau von Gauben im Dach plus Dämmung
-
Dämmung der Kellerdecke schnell und einfach
Geringerer Energieverlust im Haus dank Dämmplatten im Keller
-
mit Video
Dünne Innendämmung mit Mineraldämmplatte
Mineralische Dämmung beugt Schimmel im Innenraum vor
-
Wärmedämm-Verbundsystem aus Steinwolle-Putzträgerplatten
WDVS ohne Kompromisse bei Wärme-, Schall- und Brandschutz
-
Feuchtevariable Dampfbremse schützt Dachdämmung vor Feuchtigkeit
Vlieskaschierte Polyamidfolie beugt Feuchtigkeitsschäden vor
-
für Profis mit Video
Aufsparrendämmung senkt Heizkosten und optimiert Schallschutz
Gute Dämmung und neue Dacheindeckung zahlen sich aus
-
für Profis
Zweilagige Fassadendämmung bietet besten Wärmeschutz
Steinwolleplatten bis 400 Millimeter Dämmdicke im WDVS möglich
-
für Profis mit Video
Beanspruchtes Flachdach mit leichter Bitumenbahn sanieren
Flachdachabdichtung mit Sanierungsbahn schnell instand setzen
-
mit Video
Brandschutz erhöhen via Einblasdämmung
Installationsschachtdämmung aus nicht brennbaren Steinwollflocken
-
für Profis mit Video
Alukaschierte PIR-Gefälledämmung für Flachdächer
Zuverlässige Entwässerung und schnelle Verlegung der Dachdämmung
-
für Profis mit Video
Nichtbrennbare Steinwolledämmplatte für die Flachdachdämmung
Wirtschaftlich und sicher: Dämmplatte für verklebte Dachaufbauten
-
mit Video
Innendämmung mit Mineraldämmplatte schafft gesundes Wohnklima
Schimmel vorbeugen und Heizkosten sparen mit ökologischer Dämmung
-
-
für Profis mit Video
Schlanke und effiziente Dämmung unter den Sparren
Dachdämmung mit Dachausbau schafft neuen Wohnraum
-
für Profis
Außen geht nichts? Kellerwand von innen dämmen
Innendämmung für gesundes Wohnklima im Keller
-
-
mit Video
Lückenlos und effizient dämmen mit extra dünner Aufsparrendämmung
Hochwertige Dachdämmung schont Klima, spart Heizkosten im Altbau
-
für Profis mit Video
Flachdach abdichten mit besonders leichter Bitumenbahn
Blähglasgranulat sorgt für geringeres Gewicht der Dampfsperrbahn
-
für Profis
Hoch wärmedämmende Dämmplatte fürs Schrägdach
Erhöhter Wärmeschutz bei geringer Dämmdicke der Aufsparrendämmung
-
für Profis mit Video
Holzfaserdämmplatte mit Klimakammern für die Innendämmung
Bester Schallschutz mit nur 30 Millimetern Dämmung
-
für Profis
Flächige Verlegung der Dampfbremse schützt Dachdämmung optimal
Feuchtetransport und Luftdichtheit bei Steildachsanierung Pflicht
-
für Profis mit Video
Optimale Gefälledämmung fürs Flachdach
Angeschrägte PU-Dämmplatte erlaubt Gefälle bis zu 9,6 Meter
-
mit Video
Dachausbau: Wohngesund dämmen mit Mineralwolle-Dämmung
Ökologische und sichere Dachdämmung fürs ausgebaute Dachgeschoss
-
mit Video
Nachhaltige Dachsanierung mit neuer ECO-Aufsparrendämmung
Alte PU-Hartschaumdämmung als Basis für neue ökologische Dämmung
-
mit Video
Aufsparrendämmung überzeugt bei ausgebautem Dachgeschoss
Nachträgliche Dachdämmung mit Hochleistungs-Dämmelementen
-
für Profis
Belastbare Gefälledämmung für Flachdächer mit Photovoltaik-Anlage
Flachdachdämmplatte mit erhöhter Druckspannung
-
mit Video
Langlebige und nachhaltige Aufsparrendämmung
Sturm- und Hagelschäden mit Dachdämmung minimieren
-
mit Video
Multifunktionale Zwischensparrendämmung mit Dreifach-Schutz
Wenig Wärmeverlust, mehr Schall- und Brandschutz fürs Schrägdach
-
mit Video
Ökologischer Dämmstoff auf Biomassebasis für die Dachdämmung
Besonders dämmstark: Ökologische Aufsparrendämmung auf PU-Niveau
-
mit Video
Fassadendämmung: Holzfaserdämmplatten für WDVS
Atmungsaktive Holzfaserdämmung für Fassaden mit Kosten-Spar-Effek
-
mit Video
Dämmung mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade zahlt sich aus
Wasserabweisende Fassadendämmplatte für beste Energiebilanz
-
Abdichtung plus Trittschalldämmung für Boden mit Fliesenbelag
Feuchtigkeitsschutz und Überbrückung von Rissen in einem Schritt
-
für Profis
Nachträgliche Kerndämmung für dünnes zweischaliges Mauerwerk
Einblasdämmung: Lückenfreie Fassadendämmung mit EPS-Dämmperlen
-
für Profis
Be- und Entlüftung sowie Entwässerung auf dem Flachdach
Entwässerungs- und Lüftungselemente ergänzend zur Dachabdichtung
-
für Profis mit Video
Punktgenaue Dachentwässerung dank Dachreiter für Gefälledämmung
Damit Flachdächer langfristig trocken bleiben
-
für Profis mit Video
Mit neuer Aufsparrendämmung vom Altbau zum Passivhaus
Komplettes Sanierungssystem für zukunftssichere Dachdämmung
-
für Profis mit Video
Alte Fassadendämmung energetisch sanieren mit Sanierungskit
Aus altem WDVS wird vorgehängte hinterlüftete Fassade
-
-
für Profis mit Video
Effiziente Linienentwässerung als Set-Lösung für das Flachdach
Mit Gefälledämmung Regenwasser gezielt ableiten
-
mit Video
Sanierungsbericht Holzfaserdämmung: 500 Jahre altes Fachwerkhaus
Von Grund auf saniert und innen mit Holzfasern gedämmt
-
für Profis
Schrägdach: Befestigungsempfehlung für die Aufsparrendämmung
Schrauben für Aufsparrendämmplatten zuverlässig berechnen
-
für Profis mit Video
Kapillaraktive Innendämmung der Fassade
Wohngesunde Fassadendämmung aus Ziegeln mit Perlit-Füllung
-
für Profis
Flexibles Dämmrahmen-Set für Dachfenster
Dachflächenfenster sicher und wärmebrückenfrei dämmen
-
-
Energieeffiziente Dachdämmung mit Aufsparrendämmplatte
Aufsparrendämmung: Perfekte Ergänzung zur Zwischensparrendämmung
-
mit Video
Sanierungsbericht: Ökologische Dachdämmung 50er-Jahre-Haus
Steildachsanierung mit nachhaltigem Dämmstoff auf Biomassebasis
-
für Profis
Gesunde Raumluft: Schadstoffarme PU-Dämmstoffe für Dachdämmung
Emissionsarme Dämmung im Verzeichnis "Gesündere Gebäude" gelistet
-
für Profis mit Video
Neues Luftdichtsystem: Feuchteschutz und Brandschutz in einem
Sicheres Dach mit schwerentflammbarer Dampfbremse für Dachdämmung
-
Wärmebrückenfreie Dachbodendämmung mit Steinwolleflocken
Schütt- und Aufblasdämmung sorgen für einheitliche Dämmschicht
-
für Profis
Bauwerksabdichtung: Perimeterdämmung bei drückendem Grundwasser
Wasserabweisender Bitumen-Kleber schützt Keller-Dämmplatten
-
für Profis
Sichere Montage von Dachsystemteilen auf der Steildachdämmung
Schneefang und Co: Universelle Befestigung für Aufsparrendämmung
-
-
-
für Profis
Flachdachdämmung mit Multilayer-Technologie für Umkehrdächer
Extruderschaumplatten mit Stufenfalz verhindern Wärmebrücken
-
mit Video
Sanierungsbericht: Nachträgliche Kerndämmung Einfamilienhaus
Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk Schritt für Schritt
-
-
für Profis mit Video
Gute Kombi bei zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung und WDVS
Einblasdämmung mit Steinwolleflocken verbessert Dämmwert des WDVS
-
mit Video
Sanierungsbericht: Dämmen in Eigenleistung mit Holzfaserdämmung
Alte Käserei mit natürlicher Innendämmung zum Wohnhaus saniert
-
mit Video
Bodentreppe mit Wärmeschutz macht Dämmung von Dachboden perfekt
Dichter Einbau mit Deckenanschluss-System und spezieller Dichtung
-
Gut eingepackt: Effiziente Kerndämmung für die Fassade
Kerndämmplatte punktet mit schlankem Aufbau bei besten Dämmwerten
-
Wohnungs- oder Gebäudetrennwand nachträglich dämmen
Schallschutz verbessern mit nachhaltiger Einblasdämmung
-
mit Video
Bewährtes Duo im Altbau: Innendämmung und Wandheizung
Abgestimmtes System - Mineraldämmplatte, Wandheizung und Lehmputz
-
für Profis
Dachfenster nachrüsten mit Dämmzarge und Aufkeilrahmen
Dachfenster schnell und sicher in die Dachdämmung integrieren
-
mit Video
Zero Waste: Rückbaubares WDVS aus Mineralwolle oder Holzfaser
Recyclingfähige Fassadendämmung komplett sortenrein trennbar
-
Robuste Dämmplatten und Dämmlamellen für die Kellerdeckendämmung
Verschiedene Dämmplatten erfüllen alle Oberflächen-Ansprüche
-
Wohngesunde Einblasdämmung für die nachträgliche Fassadendämmung
Zweischaliges Mauerwerk zeit- und kostensparend dämmen
-
mit Video
Sanierungsbericht: Feuchtes Mauerwerk wohngesund saniert
Altbausanierung ohne Trockenlegung dank Entsalzungssystem
-
für Profis mit Video
Dünne Aufsparrendämmung mit Passivhaus-Zertifikat
Hochleistungsdämmstoff für Dachsanierung im Passivhaus-Standard
-
für Profis
Bester Halt für Perimeterdämmung durch Waffelstruktur
Optimal dämmen im Sockel- und Wärmebrückenbereich
-
für Profis
Dachsanierung: Kombidämmung verbessert Dämmleistung im Altbau
Aufsparrendämmung ergänzt Zwischensparrendämmung
-
Holzbauweise: Ökologische Fassadendämmung aus Holzfasern
Diffusionsoffene Holzfaserplatte für optimalen Feuchtetransport
-
für Profis
Doppelte Dachdämmung für besten Wärmeschutz
Wohlfühlklima dank Kombi aus Auf- und Zwischensparrendämmung
-
für Profis
Sicherheitsdämmbahnen mit 2-in-1-System für das Flachdach
Drei Quadratmeter Dämmung und Abdichtung in einem Arbeitsgang
-
für Profis mit Video
Zeit sparen bei der Fassadendämmung
Steinwolle-Putzträgerplatte für effiziente WDVS-Verarbeitung
-
für Profis mit Video
Mit vorgefertigten WDVS-Fensterzargen effizienter sanieren
Konfigurierbares Fensterelement vereinfacht Fassaden-Anschluss
-
mit Video
Hagelsichere, robuste Dämmplatten für die Aufsparrendämmung
Dachdämmung schützt Haus zuverlässig vor Hagelschaden
-
für Profis mit Video
Dachsanierung mit Aufsparrendämmung nach dem Dachausbau
Einbaufertige Dachdämmung für das bewohnte Dachgeschoss
-
Flachdachbefestiger für das sturmsichere Dach
Mechanische Windsogsicherung von Dachabdichtung und Dämmung
-
für Profis
Schlank oder extra ruhig: Trittschalldämmung für jeden Bedarf
Trittschallschutz mit schlankem Systemaufbau ideal für Sanierung
-
für Profis
Aufsparrendämmung für Metalldächer
Steildach mit Dacheindeckung aus Metall wirtschaftlich dämmen
-
Doppelte Dachdämmung mit Steinwolle sorgt für mehr Wohnkomfort
Vom Altbau zum zeitgemäß gedämmten Wohlfühl-Haus
-
-
für Profis mit Video
Aufsparrendämmung für gewölbte Dächer, Tonnendach und Gaube
Flexible PU-Dämmplatten vom kleinen bis zum großen Radius
-
für Profis mit Video
Schüttbarer Niveauausgleich aus Blähglasgranulat fürs Flachdach
Schnell begehbare Ausgleichsschüttung mit hoher Druckfestigkeit
-
für Profis
Biobasierte Dämmung für schlanke Dachaufbauten
Ökologische Aufsparrendämmung mit aufkaschierter Unterdeckbahn
-
Effiziente Dachbodendämmung für jeden Bedarf
Dämmvarianten für begehbare und nicht begehbare Dachböden
-
-
für Profis
Dichtklebstoff zum Verkleben von Dampfbremsen im Steildach
Luftdichter Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile
-
mit Video
Flachdach-Dämmplatte aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen
Nachhaltige Flachdachdämmung mit ökologischem Dämmstoff
-
für Profis
Kerndämmung: Steinwolle-Dämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit 033
Formstabile Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk
-
mit Video
Atmungsaktive Dämmplatten aus Holzfaser für die Fassadensanierung
WDVS der Oberklasse: Weniger Heizverluste und gesundes Raumklima
-
mit Video
Abgestimmte Systeme für die Innendämmung
Fassade im Altbau: Die alternative Art der Dämmung
-
mit Video
Die Ökologische: Dachdämmung mit Holzfaser
Bester sommerlicher Wärmeschutz mit Holzfaserdämmung
-
mit Video
Flächentemperierte Carbonbahn nutzt Strahlungswärme
Komfortabel heizen mit Flächenheizung an Wand, Decke und Boden
-
für Profis
Absturzsicherung für das Flachdach
Seilsysteme und Geländersysteme sichern Profis bei Dacharbeiten
-
Nachträgliche Hohlraumdämmung im Flachdach
Einblasdämmung aus Steinwolle für schwer zugängliche Dachbereiche
-
mit Video
Energiesparen in Eigenleistung: Dämmung der Rohrleitungen
Warmwasser- und Heizungsrohre dämmen und Wärmeverlust minimieren
-
für Profis mit Video
Innensanierungssystem befreit den Keller von Schimmel
Schnelle Maßnahmen gegen Schimmel und feuchte Kellerwände
-
mit Video
Luftreinigende Abdichtungsbahn reduziert Luftverschmutzung
Bitumendachbahn sorgt für saubere Luft auf dem Flachdach
-
für Profis
Flachdachdämmung mit ökologischen und robusten Mineraldämmplatten
Mineralische Flachdachdämmung bietet viele Vorteile bei Sanierung
-
mit Video
Dach am besten mit Aufsparrendämmung dämmen
Dünne Hochleistungsdämmplatten sind schnell verlegt
-
mit Video
Schlanke und hagelfeste Dachdämmung mit Polyurethan-Hartschaum
Steildächer energetisch aufwerten mit einer Aufsparrendämmung
-
mit Video
Sanierungsbericht Doppelhaus: Ökologisches WDVS aus Holzfaser
Heizkosteneinsparung dank nachträglicher Fassadendämmung
-
für Profis
Wohngesundheit: Das gesündere Schrägdach inklusive Dämmung
Vier zertifizierte Dachaufbauten garantieren gesunde Raumluft
-
für Profis
Mauerrandstreifen ergänzt Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk
Extruderschaumstreifen verhindern Wärmebrücken an Tür und Fenster
-
für Profis mit Video
Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte für das genutzte Flachdach
Flachdach mit Photovoltaik oder Dachterrasse ideal dämmen
-
mit Video
Zweischichtige Dämmplatte für eine sicher gedämmte Kellerdecke
Schichtaufbau schützt Dämmstoff vor Beschädigung bei der Montage
-
mit Video
Mit Hohlraumdämmung von Fassade und Co Schallschutz verbessern
Dämmung aus Steinwolleflocken sorgt für mehr Ruhe im Haus
-
für Profis
System für die Gaubensanierung ermöglicht homogene Abdichtung
Dachdämmung und Gaubendämmung aus einem Guss
-
für Profis mit Video
Ideal bei Altbausanierung: Schlankes System für die Innendämmung
Dünne Holzfaserdämmplatte sorgt für warme Innenwände ohne Dübeln
-
für Profis mit Video
Flachdach-Ausstieg für Bodentreppen
Zugang zum Flachdach mit luftdichtem Anschluss und Wärmedämmung
-
für Profis
Dachdämmung bei Denkmalschutz
Dünne Dämmplatten punkten bei Dachsanierung von altem Speicher
-
für Profis mit Video
Effiziente Wärmedämmung dank vorgehängter hinterlüfteter Fassade
Dünne Dämmplatte erzielt beste Dämmwerte bei geringer Dämmdicke
-
Nachhaltige Kellerdeckendämmung mit mineralischem Oberflächenputz
Kellerdecken gesünder, ökologisch dämmen
-
mit Video
Sommerlicher Hitzeschutz fürs Dach aus Steinwolleflocken
Einblasdämmung punktet als flexible und effiziente Dachdämmung
-
Marderschutzdach: Dachdämmung vor ungebetenen Tieren schützen
So zerstören Marder und Co nicht die Dachdämmung
-
für Profis
Schlanke Aufsparrendämmung mit integrierter Dampfsperre
Geringe Dämmstärke bei hoher Dämmwirkung für schlanken Dachaufbau
-
für Profis
Der Wärmeschutz für den Sockel: Vollmineralische Sockeldämmung
Sockeldämmplatten für die Fassadendämmung mit WDVS
-
Mit Untersparrendämmung auch den Brandschutz verbessern
Dachdämmung mit Dämmstoffen aus Mineralwolle gibt Sicherheit
-
mit Video
Dünne Innendämmung für wenig Wohnraumverlust
Fassade effektiv dämmen auch bei Denkmalschutz
-
-
Steinwolle-Kellerdeckendämmung farblich gestalten
Ansprechende Optik plus Wärmeschutz dank streichbarer Dämmplatte
-
Extraschlanke Trittschalldämmung zur Nachrüstung im Altbau
Dünnestrich erlaubt Sanierung des Fußbodens in Rekordzeit
-
Bodendämmung aus natürlichen Holzfasern
Komfortabler Trittschallschutz für Dielen, Parkett und Laminat
-
für Profis mit Video
Klinker: Schlanke Fassadenziegel für zweischaliges Mauerwerk
Reduzierte Außenschale bietet mehr Platz für Fassadendämmung
-
für Profis mit Video
Sichere und schnelle Aufsparrendämmung im Großformat
Mit XXL-Dämmplatten Dach in 90 Minuten vollständig gedämmt
-
mit Video
Wohngesunde, ökologische Innendämmung der Fassade
Fassadendämmung mit schadstofffreien Mineraldämmplatten
-
für Profis
Dämmstoff-Halter fixiert Steinwolle-Fassadendämmplatten
Vorgehängte hinterlüftete Fassade sicher befestigen
-
für Profis mit Video
Bodentreppe einbauen Schritt für Schritt
Fachgerechter, luftdichter Einbau spart deutlich Heizkosten
-
für Profis mit Video
Kombinierte Dämmung der Kellerdecke mit zwei Platten
Dämmplatten und Brandschutzplatten für Stahlbetondecken
-
für Profis mit Video
Perimeterdämmung: Vom Sockel bis zum Dach brandsicher gedämmt
Sockeldämmplatte aus Schaumglas ergänzt vollmineralisches WDVS
-
für Profis
Putzträgerplatte aus Steinwolle mit Bossennut für WDVS
Ästhetische Fassaden dank Deko-Dämmstoffplatte
-
mit Video
Kerndämmung schützt Fassade vor Feuchtigkeit
Feuchte Wände? Einblasdämmung aus Steinwolle beugt vor!
-
mit Video
Flexible Befestigung für Photovoltaik-Anlagen auf dem Flachdach
Dank Luftspalt rund 25 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung
-
für Profis
Flachdachdämmung: Verbesserter Wärmeschutz, maximaler Brandschutz
Dünne Steinwolle-Dämmplatte für höchste Anforderungen
-
für Profis
Dämmung mit Vakuumkern für Flachdach, Balkon und Terrasse
Dämmplatte mit extra dünner Aufbauhöhe bei höchster Dämmleistung
-
mit Video
Ökologische Dämmung der Kellerdecke verhindert aufsteigende Kälte
Kellerdämmung mit Mineraldämmplatten senkt Heizkosten
-
für Profis
Universalabdichtung vereinfacht Fenster-Anschlüsse an Dämmebene
Sicherer WDVS-Anschluss und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
-
-
mit Video
Untersparrendämmung ganz ohne Zuschneiden
Passgenaue Steinwolle-Dämmplatte erleichtert Dachdämmung
-
mit Video
Kerndämmung: Steinwolle-Flocken sorgen für Optimum an Dämmwirkung
Nachträgliche Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk
-
Nachträgliche Kellerdeckendämmung mit Extruder-Schaumplatten
XPS-Platten dämmen aufsteigende Kälte aus unbeheiztem Keller ein
-
mit Video
Historisches Fachwerkhaus clever saniert mit Steinwolledämmung
Einblasdämmung aus Steinwolle bewahrt denkmalgeschützte Fassade
-
für Profis mit Video
KSK-Abdichtungsbahn für dauerhaft trockene Wohnkeller
Kellerwände sicher mit "Allwetter"-Lösung abdichten
-
für Profis mit Video
Energetisch sanieren und gesund wohnen mit Lehm für die Innenwand
Lehmmörtel und Lehmfarbe für die Dämmung der Fassade von innen
-
für Profis mit Video
Luftdichtheitssystem für luftdichte Dachdämmung
Abgestimmte Komplett-Lösung hält Dach frei von Feuchtigkeit
-
mit Video
Streichbare Dämmplatte aus Steinwolle für die Kellerdecke
Kellerdeckendämmung, die sich verputzen und streichen lässt
-
für Profis
Natürliche Zwischensparrendämmung für gesundes Wohnklima
Dachdämmung mit modernem Hochleistungsdämmstoff
-
mit Video
Die Sensible: Innendämmung der Fassade
Flanken- und Laibungsplatten verhindern Wärmebrücken und Schimmel
-
mit Video
Innovative Einblasdämmung für die Fassade
Kerndämmung verbessert Wärme-, Schall- und Brandschutz
-
für Profis mit Video
Dünne Aufsparrendämmung mit besten Dämmwerten
Maximale Dämmleistung bei minimaler Materialstärke
-
für Profis
WDVS-Systemzubehör für gedämmte Fassaden
Nist-, Raffstorekästen und Co bündig in Fassadendämmung einbinden
-
-
mit Video
Moderne Innendämmung mit Mineraldämmplatten für historische Hülle
Fassadensanierung: Aus marodem Haus wird schmucke Villa
-
Schnell, flexibel und wohngesund: Einblasdämmung aus Mineralwolle
Vielseitige Dämmung für Fassade, Dach und Dachboden
-
mit Video
Schallschutz: Raumakustik verbessern mit Akustik-Dämmplatten
Nachträgliche Schalldämmung für die Decke aus Recyclingglas
-
für Profis
Unterspannbahn und Unterdeckbahn mit wasserabweisendem Vlies
Regensicheres Unterdach schützt Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit
-
für Profis
Fassadensanierung für alte Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
Wirtschaftliches Sanierungsverfahren für WDVS mit Kunstharzputz
-
für Profis mit Video
Hochdämmende Planziegel mit Mineralwolledämmung für Ziegelwände
Fassade von Mehrfamilienhäusern wärme- und schallschutzoptimieren
-
mit Video
Garantiert schimmelfrei mit Holzfaserdämmplatte
Kapillar aktive Innendämmung für die Fassade ohne Dampfsperre
-
mit Video
Erstes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit dem Blauen Engel
Umweltsiegel für natürliche Fassadendämmung
-
für Profis mit Video
Beschichtete Dämmplatte aus Steinwolle als Kernstück für WDVS
Fassadendämmung mit hoher Abreißfestigkeit und Dübeltragfähigkeit
-
mit Video
Heizkomfort trifft Design: Modernes Truhen- und Wand-Klimagerät
Heizen, Kühlen und Luftreinigung mit nachhaltiger Klimaanlage
-
Steinwolle-Lamellen für gewölbte Kellerdecken
Flexible Kellerdeckendämmung ideal bei Kellergewölbe im Altbau
-
für Profis mit Video
Bodendämmung: Trittschalldämmung aus nichtbrennbarer Steinwolle
Maximale Stabilität bei minimaler dynamischer Steifigkeit
-
für Profis
Einblasdämmung: Steinwolle-Granulat für den Holzbau
Holzhaus hohlraumfrei dämmen an nur einem Tag
-
Sanierungsforum
-
Bekomme ich Fördermittel für den Fernwärme-Anschluss, ohne die Heizung auf Fernwärme umzustellen? Jan-Christoph H. am 22.04.2024
Das ist aller Voraussicht nicht möglich. Denn die Förderung für Fernwärme gibt es nach Punkt 5 der BEG-EM-Richtlinie für "[...] ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für den Austausch der Scheiben in unseren Fenstern? Dieter R. am 22.04.2024
Bei der Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren ist zur Förderung des Scheibentauschs ein Uw-Wert von 1,3 W/m²K zu erreichen. ...
Antwort lesen » -
Benötige ich auch bei Eigenleistung einen Vertrag mit auflösender/aufschiebender Bedingungen bei der Förderung? Linnea S. am 22.04.2024
Nach Angaben des BMWK ist ein Vertrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung bei Förderung von Eigenleistung nicht zwingend erforderlich. ...
Antwort lesen » -
Sind die Seiten der Rollladenkästen ebenfalls zu dämmen? Jens H. am 22.04.2024
Üblicherweise bleiben die Flanken frei. Bausätze zur Rollladendämmung, die meist aus drei Teilen bestehen, sitzen in der Regel dicht längs ...
Antwort lesen » -
Kann ich eine Förderung der Heizung beantragen, wenn ich noch nicht im Haus wohne? Helen K. am 21.04.2024
Um Fördermittel zu bekommen, müssen Sie nachweislich Eigentümerin der Immobilie sein. Ist das der Fall, können Sie die Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Ist eine Wärmepumpe mit R410A als Kältemittel heute noch zu empfehlen? L. K. am 21.04.2024
Generell sind hier vermutlich keine Einschränkungen zu erwarten, da das Kältemittel der Wärmepumpe in aller Regel nicht getauscht werden ...
Antwort lesen » -
Was ist bei Angeboten und Rechnungen zu beachten, wenn ich eine Förderung für die Wärmepumpe nutzen möchte? Volker W. am 21.04.2024
Geht es um die Förderung der Wärmepumpe, müssen Sie die technischen Vorgaben des Fördergebers erfüllen. Relevant ist dabei der ...
Antwort lesen » -
Kann ich die Zwischensparrendämmung im Dach im Zuge der Sanierung erweitern? Sascha H. am 21.04.2024
Grundsätzlich ist es möglich, eine Untersparrendämmung zu ergänzen, um den U-Wert des Daches zu verbessern. Diesen können Sie dazu mit ...
Antwort lesen » -
Muss die neue Heizung für die Förderung das gesamte Haus beheizen und kann ich mehrere Anträge zur Heizungsförderung stellen? Florian E. am 20.04.2024
Sie bekommen die Förderung für die neue Heizung auch dann, wenn diese nur einen Teil des Gebäudes mit Wärme versorgt. Voraussetzung ist, ...
Antwort lesen » -
Muss ich einen neuen Warmwasserbereiter installieren, um den Geschwindigkeits-Bonus für die Wärmepumpe zu bekommen? Sascha R. am 20.04.2024
Die Anforderungen der Heizungsförderung beziehen sich auf neue und bestehende Technik. Erfüllen Sie mit der installierten Anlagentechnik ...
Antwort lesen » -
Ist mein Nachtspeicherofen von Siemens mit Asbest belastet? Laurens R. am 19.04.2024
Bei Siemens sind folgende Nachtspeicheröfen mit Asbest belastet: Typ HR, HV, 2NV3, 2NV7 bis Baujahr 1972; 2NV1, 2NV3, 2NV5 bis Baujahr ...
Antwort lesen » -
Ab wann kann ich die BEG-EM-Förderung für die Heizung im Mehrfamilienhaus beantragen? Wolfgang F. am 19.04.2024
Das Portal der KfW ist voraussichtlich ab Ende Mai 2024 für die Antragstellung vorbereitet. Ab dann können Energieberater oder ...
Antwort lesen » -
Was ist zu beachten, wenn ich im Neubau eine Elektroheizung einbauen möchte? Jens F. am 19.04.2024
Interessieren Sie sich für eine Infrarotheizung im Neubau, gilt § 71 d des Gebäudeenergiegesetzes. Dieser fordert, dass Sie die ...
Antwort lesen » -
Wie können wir die 70-Prozent-Kappung an unserer Photovoltaikanlage entfernen? Sabine M. am 19.04.2024
Haben Sie bereits ein Smart-Meter-Gateway, ist die Abschaffung der Kappung für Anlagen mit mehr als 7 kWp möglich. Wie Sie dabei am besten ...
Antwort lesen » -
Kann ich die Innenwand im Fachwerk mit Holzfasern dämmen und mit Rigips verkleiden? Michael K. am 19.04.2024
Infrage kommen hier Holzweichfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten, die beide Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und transportieren ...
Antwort lesen » -
Kann ich eine Einrohrheizung sanieren und eine Wärmepumpe nachrüsten? Konrad V. am 19.04.2024
Generell schließt sich das nicht aus. Technisch bedingt bietet eine Einrohrheizung aber nicht die besten Voraussetzungen für eine ...
Antwort lesen » -
Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren? Christoph L. am 18.04.2024
Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...
Antwort lesen » -
Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist? Robert S. am 18.04.2024
In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...
Antwort lesen » -
Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben? Klaus S. am 18.04.2024
Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...
Antwort lesen » -
Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen? Helga S. am 17.04.2024
Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage? Jana K. am 17.04.2024
Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...
Antwort lesen » -
Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen? Andreas K. am 17.04.2024
Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...
Antwort lesen » -
Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen? Christian Z. am 17.04.2024
Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt? Christian L. am 17.04.2024
In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung? Dominik S. am 17.04.2024
Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung? Horst S. am 17.04.2024
In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...
Antwort lesen » -
Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen? Katharina M. am 16.04.2024
Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue? Alp Y. am 15.04.2024
Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet? Manfred H. am 15.04.2024
Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...
Antwort lesen » -
Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren? Martino B. am 14.04.2024
Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort





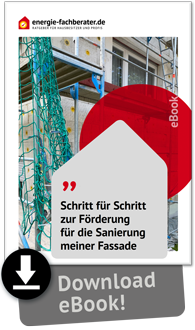
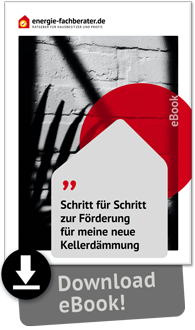
 Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden
Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden